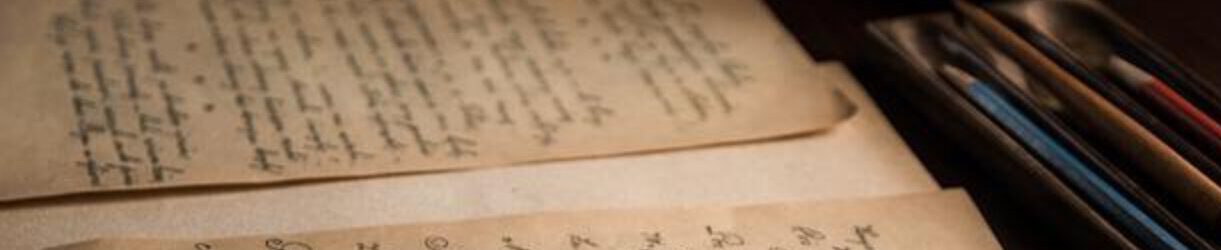Ein nationalsozialistisches Europa
Noch während des Feldzuges gegen Frankreich begannen in der Führung des Regimes die Planungen für das Europa der Nachkriegszeit. Staatssekretär Ernst von Weizsäcker im Reichsaußenministerium hegte am 23. Mai 1940 Zweifel, ob das Deutsche Reich dazu in der Lage wäre:
„Ebenso interessant wird ja auch die Methode, den pangermanischen Kontinent zusammenzuhalten, als wirtschaftliche Einheit, aber auch politisch u. moralisch. Welches ist der tragende Gedanke dieses neuen Reiches, der anstelle der eisernen Waffenklammer treten soll, um die heterogenen Völker zusammenzuhalten? Ein ‚Konsumverein‘ allein tut es doch nicht“ (Hill 1974, S. 205).
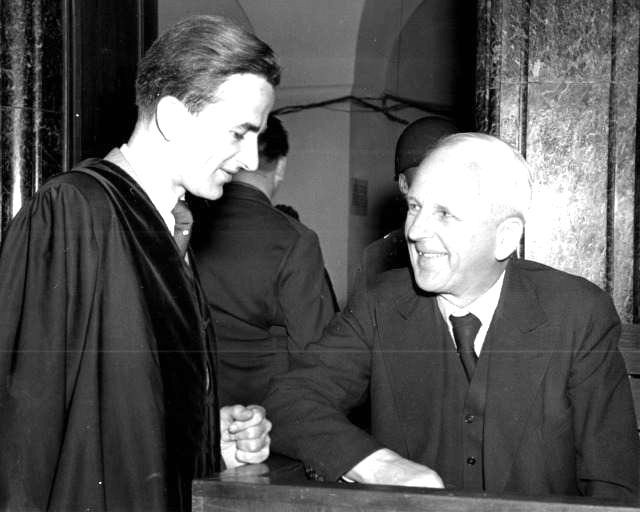
Ein Konzept für eine neue europäische Ordnung besaß das Regime nicht (vgl. Umbreit in Michalka 1989, S. 711). Wenn Hitler vom „alte(n) Europa“ sprach, dass „sich letzten Endes doch als der stärkste geistige Faktor erweisen“ würde, dann war dies nur eine rhetorische Floskel (Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, Serie E, Band V, 1978, S. 93, Dok. 45). Der Diktator dachte nicht in den Kategorien eines historisch gewachsenen Staatensystems. Europa betrachtete er „als einen blutsmäßig bedingten Begriff“ (Jacobsen in Bracher, Funke, Jacobsen 1983, S. 437).
Die verfügbaren Quellen lassen darauf schließen, dass die Hakenkreuzfahne nach dem Krieg über Dänemark, den Niederlanden und Norwegen geweht hätte. Frankreich hätte Gebiete abtreten müssen und wäre nur als Satellitenstaat erhalten geblieben. Osteuropa und Teile Russlands sollten wie Kolonien die Rohstoffe und Arbeitskräfte liefern (vgl. Neulen 1987, S. 397; Bloch 1993, S. 378).
Eine neue europäische Ordnung?
Nach den Rückschlägen in Nordafrika im November 1942 und Stalingrad Anfang Februar 1943 konnte Deutschland nicht mehr aus einer Position der Stärke heraus gegenüber seinen Verbündeten auftreten.
Propagandaminister Goebbels erwirkte am 23. Januar 1943 von Hitler die Genehmigung, „ein Europa-Programm zu entwickeln, das in allgemeiner Form Europa ein neues Statut geben soll“ (Fröhlich 1993, S. 180). Mit der Veröffentlichung wollte das Regime warten, bis sich die militärische Lage gebessert hatte. Vorerst begnügte sich Goebbels damit, neue Propagandarichtlinien herauszugeben. Von einer grundlegenden Änderung der deutschen Politik konnte keine Rede sein. Vom Ziel einer rassenideologisch begründeten Hegemonie machte er keine Abstriche.
Und welche Rolle spielte das Reichsaußenministerium? An sich hätte die Wilhelmstraße (die Adresse der Behörde in Berlin) gerade in dieser Frage federführend sein müssen. Doch seit dem Angriff auf Russland im Juni 1941 ging der Einfluss der Diplomaten zurück (vgl. Weizsäcker 1950, S. 319). Spätestens nach dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten verwaltete die traditionsreiche Behörde nur noch eine Konkursmasse: 1942 unterhielten lediglich 22 Staaten diplomatische Beziehungen zum Reich (vgl. Seabury 1956, S. 167 f.). Andere Aufgaben kamen auf das RAM zu. Das Ministerium leistete Mithilfe bei der Ermordung der europäischen Juden, beriet das OKW vor militärischen Aktionen und versuchte, die eigene Auslandspropaganda zu intensivieren.
Der Einfluss der Wilhelmstraße auf die Besatzungspolitik war beschränkt. Nur in Paris und Kopenhagen unterhielt das Reich Botschaften. In Norwegen und den Niederlanden residierten Reichskommissare und in Belgien und Nordfrankreich amtierte ein Wehrmachtsbefehlshaber, der auch politische Funktionen wahrnahm. Für die Ostgebiete war ein eigenes Ministerium unter Führung des Parteiideologen Alfred Rosenberg geschaffen worden.

Der Außenminister versuchte, die ihm verbliebenen Kompetenzen zu verteidigen. Das Reichsaußenministerium beschäftigte zwischen 1939 und 1945 mehr Personal als vor dem Krieg (vgl. Bloch 1992, S. 377). Nicht nur regimeinterne Machtkämpfe beschnitten die Einflussmöglichkeiten der Wilhelmstraße. Auch die ideologischen Prämissen Hitlers machten eine traditionelle Diplomatie überflüssig. Für den Diktator bedeutete Krieg ein Kampf um ‚Sein oder Nichtsein‘. Kompromisse lehnte er ab. Als Ribbentrop im Februar 1943 den Vorschlag unterbreitete, mit der Sowjetunion über einen Sonderfrieden zu verhandeln, wies Hitler diesen Vorschlag zurück (vgl. Ribbentrop 1953, S. 264).
In der Europapolitik unterstützte der Außenminister die Linie des Diktators aus Überzeugung. Wie Hitler glaubte er nicht, dass eine Lockerung des Besatzungsregimes dem Reich Vorteile brächte. Selbstständige Regierungen in Westeuropa würden nur mit den Engländern konspirieren, meinte Ribbentrop im April 1943, als sein italienischer Kollege Bastianini eine diesbezügliche Initiative ansprach (vgl. Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, Serie E, Band V, 1978, S. 554, Dok. 286). Was die zukünftige Nachkriegsordnung anging, strebte der Außenminister ebenfalls eine Vormachtstellung für das Deutsche Reich in Europa an. Den Nachbarn des Reiches wäre dabei eine – eher formale – Unabhängigkeit eingeräumt worden.
Interessant ist in diesem Zusammenhang das Projekt eines Europäischen Staatenbundes, dessen Entwurf der Außenminister am 21. März 1943 Hitler zukommen ließ. Ribbentrop regte darin an, einen föderativen Zusammenschluss zu proklamieren, sobald ein militärischer Erfolg eingetreten wäre. Deutschland, Italien, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Finnland, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Serbien, Griechenland und Spanien (mit einem Fragezeichen versehen) sollten in Salzburg oder Wien diesem Staatenbund beizutreten.
Die Wilhelmstraße versuchte, Eigenständigkeit zu demonstrieren, ohne in Gegensatz zu Hitler zu geraten. Auch wenn von Staaten die Rede war, Ribbentrop und seine Berater ließen keinen Zweifel daran, dass Berlin die Geschicke des Kontinents bestimmen wollte: „Wenn wir überall, d. h. in etwaigen Staatsgebilden, immer die richtigen harten Leute von uns einsetzen, die bei aller äußeren Geschmeidigkeit das reale Ziel kompromisslos verfolgen, präjudizieren wir durch einen solchen Staatenbund gar nichts, sondern die Gründung des Großgermanischen Reiches am Ende des Krieges ist dann eine Selbstverständlichkeit“ (vgl. Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, Serie E, Band V, 1978, S. 439, Dok. 229).
Die Proklamation sollte Verbündeten und Neutralen vorgaukeln, dass Deutschland einen Krieg für die Interessen Europa führen würde. In Wirklichkeit war das Reich darauf angewiesen, die besetzten Länder rücksichtslos auszuplündern (vgl. Snell 1966, S. 105). Gegenüber Gauleitern der NSDAP ließ Hitler am 8. Mai 1943 keinen Zweifel daran, „daß das Kleinstaatengerümpel, das heute noch in Europa vorhanden ist, so schnell wie möglich liquidiert werden muß. Es muß das Ziel unseres Kampfes bleiben, ein einheitliches Europa zu schaffen. Europa kann aber eine klare Organisation nur durch die Deutschen erfahren. Eine andere Führungsmacht ist praktisch nicht vorhanden“ (Lochner 1948, S. 325).
Das Reichsaußenministerium und Europa
Im September 1943 wurden dem Reichsaußenminister mehrere Denkschriften vorgelegt, die das Thema Europa behandelten. Ribbentrop duldete konzeptionelle Arbeiten, um den Führungsanspruch seines Hauses auf dem Gebiet der Außenpolitik geltend zu machen. Als der Diplomat Rudolf Rahn am 19. August 1943 eine Ausarbeitung vorlegte, in der er für eine konstruktive Europapolitik eintrat und entsprechende Anregungen machte, ging der Chef der Wilhelmstraße auf die Vorschläge nicht ein (vgl. Rahn 1949, S. 225). Auf die ihm vorgelegten Denkschriften wird Ribbentrop ähnlich reagiert haben – sie beeinflussten nicht die deutsche Außenpolitik im Herbst 1943.
Dennoch ist es aufschlussreich, einen Blick auf ihren Inhalt zu werfen, zeigen sie jedoch, wie man im Reichsaußenministerium die Situation beurteilte. Gemeinsam ist den Initiativen, dass sie versuchen, zumindest in Umrissen eine Vorstellung von der zukünftigen politischen Ordnung in Europa zu entwerfen. Schon dadurch unterschieden sie sich von der bisherigen Praxis, keine Zusagen zu machen, um sich später nicht zu binden. Die militärische Situation, so die Diplomaten, lasse dem Reich jedoch keine andere Wahl (vgl. Notiz des Gesandten Cecil von Renthe-Fink vom 9. September 1943, in Hass, Schumann 1972, S. 198).
Nach den Vorstellungen der Wilhelmstraße sollte Europa in Form eines Staatenbundes organisiert werden (vgl. Notiz Renthe-Fink vom 9. September 1943, S. 199, in Hass, Schumann 1972, S. 199). Im Gegensatz zu dem Vermerk, denn Ribbentrop im Frühjahr vorlegte, gehen die Verfasser auf die innere Ausgestaltung des Bundes ein. Sie betonten den Gedanken der freiwilligen Zusammenarbeit und sprachen davon, dass „jeder Gliedstaat des europäischen Staatenverbundes“ das Recht haben sollte, „sein nationales Leben nach eigenem Ermessen … zu gestalten“ (Entwurf für eine Denkschrift des Auswärtigen Amtes in Hass, Schumann 1972, S. 207).
Der Gesandte Renthe-Fink plädierte dafür, Frankreich durch Gebietszusagen entgegenzukommen sowie Holland, Belgien und Norwegen als „gleichberechtigte Gliedstaaten“ in den Staatenbund aufzunehmen (vgl. Notiz Renthe-Fink in Hass 1972, S. 200). Im Entwurf für eine Denkschrift dachten die Planer des Reichsaußenministeriums nicht in völkischen Kategorien, sondern betrachteten „als Fundament nur die geschichtliche Entwicklung, die zu einem ausgeprägten Nationalbewusstsein aller europäischen Völker geführt hat und die realpolitischen Tatsachen“ (Hass, Schumann 1972, S. 205).
Dies bedeutete jedoch nicht, dass man sich im Ministerium grundsätzlich von den Vorstellungen des Regimes distanzierte. Die Entwürfe plädieren für eine deutsche Großmachtpolitik, die elastischer vorgeht, aber dem Deutschen Reich trotzdem die Möglichkeit eröffnete, bei Bedarf in die inneren Verhältnisse einzugreifen (vgl. Hass, Schumann 1972, S. 207). Die Wiederherstellung Polens als unabhängiger Staat lehnte von Renthe-Fink ab; selbst eine „Scheinregierung“ kam für ihn als Zugeständnis nicht infrage (Notiz Renthe-Fink in Hass, Schumann 1972, S. 201).
Die aggressive Haltung gegenüber dem östlichen Nachbarstaat reichte bis in die Zeit der Weimarer Republik zurück. Hitler Vorstellungen vom ‚rassereinen Lebensraum‘ im Osten stellten nicht den ersten Versuch dar, auf Kosten Russlands eine Hegemonialstellung zu erringen. Am Ende des Ersten Weltkrieges hatte Deutschland im Frieden von Brest-Litowsk einen ähnlichen weg beschritten (vgl. Hildebrand 1995, S. 370). Damit sollen nicht Kausalketten zwischen dem Kaiserreich und dem Nationalsozialismus gebildet werden. Hitler war keineswegs der Vollender der Revisionspolitik der Zwanzigerjahre oder der Vollstrecker des wilhelminischen Imperialismus. Doch es gibt Denkmuster deutscher Großmachtpolitik, die sich im Kaiserreich herausbildeten und die es konservativen Karrierediplomaten wie dem Gesandten Renthe-Fink – er trat 1913 in das Auswärtige Amt ein – ermöglichten, dem NS-Regime zu dienen.
Dem Reichsaußenministerium ging es 1943 keineswegs darum, Europa auf „föderativer und paritätischer Basis“ zu gestalten, wie der Gesandte Wipert von Blücher nach dem Krieg behauptete (Blücher 1951, S. 337). Wie die nationalkonservativen Spitzenbeamten dachten, brachte Staatssekretär Ernst von Weizsäcker im August 1942 zum Ausdruck: Ich glaube eben, daß für eine europäische Ordnung die Engländer zu sehr am Rande leben, die Russen zu kulturlos sind und, wenn überhaupt jemand, nur wir zur Führung bestimmt sein können“ (Hill 1974, S. 296). Die Russen als kulturlos zu bezeichnen, ist zwar etwas anderes als von ‚Untermenschen‘ oder ‚rassisch minderwertigen Personen‘ zu sprechen, wie es innerhalb der NSDAP üblich war, doch die Entwertung und Herabstufung eines ganzen Volkes kommt in diesen Worten klar zum Ausdruck.
Deutschland hatte seinen europäischen Nachbarn nicht anzubieten außer Demütigung und Entrechtung. Nur mit militärischer Gewalt hatte es seine Ziele erreichen können. Schon vor der bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai 1945 hatte Deutschland den Krieg politisch verloren.
Links zu Texten mit weiterführenden Informationen:
Profit Over Life | The Nuremberg Pharma Tribunal | www.pharma-over-life.org (profit-over-life.org)
Text einer Rede, die Adolf Hitler am 30. Januar 1944 zum Thema Europa hielt.
Deutschland in der Defensive — Dr. Katharina Kellmann (katharinakellmann-historikerin.de)
Ein Beitrag über die militärische Situation Deutschlands Im Jahr 1943
Gedruckte Quellen
Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918 – 1945, Serie E: 1941 – 1945, Band V: 01. Januar bis 30. April 1943, Göttingen 1978
Domarus, Max (Hrsg.): Hitler. Reden und Proklamationen 1932 – 1945. Kommentiert von einem Zeitgenossen. Teil II, Untergang, Band 4: 1941 – 1945, 4. Aufl., Leonberg 1988
Fröhlich, Elke (Hrsg.). Die Tagebücher von Joseph Goebbels, Band 7, Teil 2, Diktate 1941 – 1945, Januar – März 1943, München, New Providence, London, Paris 1993
Hass, Gerhart; Schumann, Wolfgang (Hrsg.): Anatomie der Aggression. Neue Dokumente zu den Kriegszielen des faschistischen deutschen Imperialismus im Zweiten Weltkrieg, Berlin 1972
Hill, E. Leonidas (Hrsg.): Die Weizsäcker-Papiere, Band 2, 1933 – 1950, Frankfurt/M. Berlin, Wien 1974
Literatur
Bloch, Michael: Ribbentrop, London, New York, Toronto, Sidney, Auckland 1992
Blücher, Wipert v.: Gesandter zwischen Diktatur und Demokratie, Wiesbaden 1951
Hildebrand, Klaus: Das vergangene Reich, Stuttgart 1995
Hillgruber, Andreas; Förster, Jürgen: Zwei Aufzeichnungen über Führer-Besprechungen aus dem Jahre 1942, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 1/72, S. 109 – 126
Hoehne, Heinz: Canaris Patriot im Zwielicht, München 1974
Neulen, Hans-Werner: Europa und das 3. Reich. Einigungsbestrebungen im deutschen Machtbereich 1939 – 1945, München 1987
Rahn, Rudolf: Ruheloses Leben, Düsseldorf 1974
Ribbentrop, Joachim v.: Zwischen London und Moskau. Erinnerungen und letzte Aufzeichnungen. Aus dem Nachlass herausgegeben von Annelies v. Ribbentrop, Leonie am Starnberger See 1953
Seabury, Paul: Die Wilhelmstraße. Die Geschichte der deutschen Diplomatie 1930 – 1945, Frankfurt/M. 1956
Snell, John L.: Illusionen und Realpolitik. Die diplomatische Geschichte des 2. Weltkrieges, München 1966
Umbreit; Hans: Die deutsche Besatzungsverwaltung. Konzept und Typisierung, in: Michalka, Wolfgang (Hrsg.) Der Zweite Weltkrieg. Analysen. Grundzüge. Forschungsbilanz, München 1989, S. 710 – 727
Weizsäcker, Ernst v.: Erinnerungen, München, Leipzig, Freiburg 1950