Wilhelm II., der am 15. Juni 1888 deutscher Kaiser wurde, wollte das Kaiserreich herrlichen Zeiten entgegenführen (vgl. Craig 1985, S. 89). Als er 1913 sein silbernes Thronjubiläum beging, war Deutschland eine aufstrebende Nation, die England, das Mutterland der Industrialisierung, in einigen Bereichen hinter sich gelassen hatte. Fünf Jahre später hatte das Kaiserreich einen Mehrfrontenkrieg gegen eine übermächtige gegnerische Koalition trotz zahlreicher Siege verloren. Wilhelm II. ging nach Holland ins Exil, wo er bis zu seinem Tod 1941 lebte. Deutschen Boden hat er nicht mehr betreten.
Inhaltsverzeichnis:
- Jugend und Ausbildung
- Wilhelm II. und der „Neue Kurs“
- Das „persönliche Regiment“
- Weltpolitik und Flottenbau
- Die Daily-Telegraf-Affäre
- Weltkrieg
- Wilhelm II. und seine Verantwortung

Die Verfassung des Reiches aus dem Jahr 1871 billigte dem Monarchen mehr als nur repräsentative Befugnisse zu. Wilhelm II. war auch König von Preußen, dem größten Bundesstaat. Er führte den Oberbefehl über Heer und Marine. Ohne Zustimmung des Reichstages konnte er den Krieg erklären, wenn das Reich angegriffen wurde. Die Ernennung des Reichskanzlers fiel ebenfalls in seine Prärogative. Hoheitsakte des Monarchen bedurften allerdings der Gegenzeichnung durch den Reichskanzler.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er in der deutschen Geschichtswissenschaft als Randfigur behandelt (vgl. Craig 1985, S. 83). Seit den Sechzigerjahren konzentrierte sich eine neue Historikergeneration auf die Strukturen von Politik und Gesellschaft im Kaiserreich. Lange Zeit galt die Biografie des Engländers Michael Balfour aus dem Jahr 1967 als grundlegende Arbeit über den Kaiser.
Von 1993 bis 2008 veröffentlichte der ebenfalls in England lehrende Historiker John C.G. Röhl eine dreibändige Biografie mit etwas mehr als 4100 Seiten, die heute zu den Standardwerken zählt. 4100 Seiten über einen Monarchen, der gescheitert war – nur wenige Fürsten aus dieser Epoche wecken so viel Interesse. Röhl erschloss bis dahin nicht genutztes Quellenmaterial und zeichnete ein sehr kritisches Bild des deutschen Staatsoberhauptes. Christopher Clark legte 2008 eine Studie über den Kaiser vor, die andere Akzente als Röhl setzte. Clark kommt zu der Feststellung, dass Wilhelm II. letztlich scheiterte, betonte aber auch, dass seine Politik – zum Beispiel der Flottenbau – in der deutschen Gesellschaft auf ein mehrheitlich positives Echo stieß. In Deutschland stellte Wolfgang J. Mommsen 2005 die Frage nach der Verantwortung Wilhelms und betonte die Mitverantwortung der Umgebung des Monarchen.
Jugend und Ausbildung
Der spätere Kaiser wurde am 27. Januar 1859 in Berlin geboren. Die Geburt verlief schwierig. Der Prinz kam mit einem behinderten linken Arm zur Welt und seinen Eltern fiel es schwer, sich damit abzufinden. Zum Erzieher des Prinzen wurde 1866 Dr. Georg Hinzpeter bestellt, ein nüchterner und pedantischer Calvinist. Der als verwöhnt geltende Wilhelm sollte von Hinzpeter nicht nur unterrichtet, sondern auch an Arbeit und Disziplin gewöhnt werden (vgl. Whittle 1982, S. 49). Sein tägliches Pensum betrug 12 Stunden. Mit 10 Jahren wurde er als Leutnant in das Militär aufgenommen. Neben Latein, Französisch und Mathematik stand nun gelegentlich Marschieren auf dem Stundenplan. Wilhelm war gerne Soldat. Daneben interessierte er sich für Literatur. In seiner knapp bemessenen Freizeit malte er (vgl. Whittle 1982, S. 60).
1873 bestand er die Aufnahmeprüfung für das Gymnasium in Kassel, das er zusammen mit seinem Bruder Heinrich unter der Obhut von Hinzpeter besuchen sollte. Im Januar 1877 machte er das Abitur. Wilhelm verfügte über eine gute Allgemeinbildung. Er sprach fließend Englisch und Französisch und begeisterte sich für deutsche Literatur, Geschichte und Archäologie. Die Naturwissenschaften lagen ihm weniger, was ihn jedoch nicht daran hinderte, sich für technische Probleme zu interessieren.
Mit 18 Jahren wurde Wilhelm volljährig und erhielt einen eigenen Haushalt. Von seinen Eltern entfremdete er sich immer mehr. Der Kronprinz und seine Frau sympathisierten mit dem linken Flügel der Nationalliberalen und lehnten die Politik Bismarcks ab (Ein liberaler Preuße — Dr. Katharina Kellmann (katharinakellmann-historikerin.de). Der junge Prinz bekannte sich dagegen zu den konservativen Ansichten seines Großvaters, Kaiser Wilhelm (vgl. Ziekursch 1927, S. 428). Bestärkt wurde er in seiner Haltung von seinen Regimentskameraden in der Potsdamer Garnison, wo er als Offizier Dienst tat. Auch ein Studium generale an der Universität Bonn von 1877 bis 1879 änderte nichts an seiner Vorliebe für alles Militärische. 1881 heiratete er Prinzessin Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Im Winter 1882/83 wurde er in die Finanzverwaltung abgeordnet; 1886/87 absolvierte er ein Praktikum im Auswärtigen Amt. Doch die meiste Zeit verbrachte er beim Militär, wo er mit 29 Jahren den Rang eines Generalmajors erreichte.
Zu diesem Zeitpunkt traten die negativen Seiten seines Charakters deutlich hervor. Wer ihn näher kennenlernte, traf auf einen jungen, unausgereiften Menschen mit guten Anlagen, aber wenig Disziplin (vgl. Ziekursch, S. 425). Hinzpeters Erziehungsmethoden hatten das Gegenteil erreicht. Hinzu kam die höfische Gesellschaft, die in dem jungen Prinzen den kommenden Mann sah und ihn umschmeichelte. Wilhelm I. war hochbetagt. Kronprinz Friedrich machte einen resignierten Eindruck und erkrankte 1887 an Kehlkopfkrebs. Im politischen Berlin richteten sich die Augen auf Prinz Wilhelm.
Wilhelm II. und der „Neue Kurs“
Am 15. Juni 1888 verstarb Kaiser Friedrich III. Nur 99 Tage hatte er als Monarch geherrscht. Mit 29 Jahren bestieg Wilhelm II. den Thron und bestätigte Bismarck im Amt des Reichskanzlers. Aber schon bald kam es zwischen dem Fürsten und dem jungen Monarchen zu schweren Auseinandersetzungen. Wilhelm II. wollte – auch unter dem Einfluss seines ehemaligen Erziehers Hinzpeter – die Arbeiterschaft durch den Ausbau der Sozialpolitik für den Staat gewinnen. Die Sonntags- und Nachtarbeit sollte verboten werden. Frauen und Kinder sollten nicht mehr unter Tage arbeiten dürfen. Wilhelm II. plante ferner die Einführung von Arbeiterausschüssen in den Betrieben. Eine internationale Konferenz sollte diese Bestimmungen auch in anderen europäischen Staaten einzuführen (vgl. Ziekursch 1927, S. 438). Bismarck hielt dieses Vorhaben für unklug. Der Reichskanzler wollte stattdessen mit noch mehr repressiven Mitteln den Einfluss der Sozialdemokratie bekämpfen.
Die verschärfte Fassung des Sozialistengesetzes scheiterte im Reichstag. Wilhelm II. war nun endgültig entschlossen, den Fürsten aus dem Amt zu drängen. Am 20. März 1890 entließ er den Reichskanzler, der sich auf seine Güter zurückzog und fortan aus der Distanz die Politik des Kaisers kritisch kommentierte.
Die Ablösung Bismarcks, der fast drei Jahrzehnte die preußisch-deutsche Politik bestimmt hatte, wurde von einer Mehrheit der Deutschen begrüßt. Seine Kritiker bemängelten, dass er bei allen Verdiensten mit seiner Politik die Deutschen gespalten hätte. Wenn Wilhelm II. die Arbeiterschaft mit dem Staat versöhnen wollte, konnte er mit einer breiten Zustimmung rechnen.
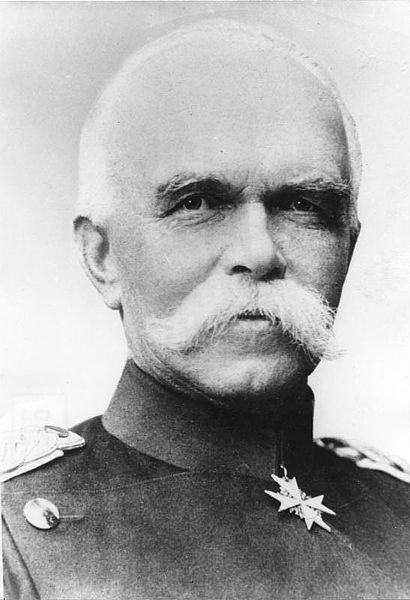
In den Amtssitz des Reichskanzlers zog ein General ein: Leo von Caprivi. Der Offizier besaß keine politischen Erfahrungen. Schon wenige Tage nach seiner Ernennung musste er eine Entscheidung treffen, die einen der Stützpfeiler des von Bismarck errichteten Bündnissystems betraf. In Berlin schlugen russische Unterhändler vor, den sogenannten Rücksicherungsvertrag zu verlängern. Bismarck wollte mit diesem Abkommen 1887 ein französisch-russisches Bündnis verhindern. Der neue Reichskanzler lehnte ab, weil es dem 1879 geschlossenen Vertrag mit Österreich-Ungarn widersprach (vgl. Röhl 2001, S. 388). Caprivi wollte die Glaubwürdigkeit Deutschlands nicht infrage stellen. In seiner Außenpolitik verfolgte er defensive Ziele und förderte eine Annäherung an England.
Im Innern setzte er die Vorstellungen Wilhelms zur Sozialpolitik um. Im Gegensatz zu Bismarck nahm er das Parlament ernst. Allerdings verstand er sich nicht als parlamentarisch verantwortlicher Reichskanzler, sondern wollte das Programm des „Neuen Kurses“, wie die Politik Wilhelms genannt wurde, mit einer Mehrheit des Reichstages durchsetzen. Die Auseinandersetzung mit der Sozialdemokratie sollte mit politischen Mitteln geführt werden. Dazu gehörten Handelsverträge mit dem Ziel, der deutschen Industrie neue Absatzmärkte zu erschließen. Ein entsprechendes Abkommen mit Russland ermöglichte die Einfuhr von billigem Getreide (General Leo von Caprivi und der „Neue Kurs“ — Dr. Katharina Kellmann (katharinakellmann-historikerin.de)
Caprivis Politik stieß auf den Widerstand in konservativen Kreisen (vgl. Balfour 1973, S. 182). Viele Großgrundbesitzer hatten von der Schutzzollpolitik Bismarcks profitiert. Nun sahen sie sich in ihrer Existenz bedroht und organisierten sich im „Bund der Landwirte“. Die sozialpolitischen Zugeständnisse konnten nicht verhindern, dass die Sozialdemokraten bei den Reichstagswahlen 1893 starke Gewinne erzielten. Die moderate Außenpolitik des Reichskanzlers rief die Kritik nationalistischer Kreise hervor, die auf weitere Kolonien hofften. Im „Helgoland-Sansibar-Vertrag“ mit England hatte das Deutsche Reich 1890 auf seine Interessen in Sansibar verzichtet und im Gegenzug die Insel Helgoland in der Nordsee erhalten. Die Befürworter einer expansiveren Kolonialpolitik waren enttäuscht und gründeten 1891 den Alldeutschen Verband.
Wilhelm II. hatte sein Interesse an einem Ausgleich mit der Sozialdemokratie verloren (vgl. Stürmer 1983, S. 274). Die streng verfassungsmäßige Regierungsweise des Reichskanzlers missfiel ihm und den Reichstag betrachtete er mit Misstrauen und Argwohn. 1894 entließ er Caprivi und ernannte Fürst Hohenlohe-Schillingsfürst, einen liberal-konservativen Aristokraten, zum Nachfolger.
Das „persönliche Regiment“
Der neue Reichskanzler war 75 Jahre alt, als er das Amt übernahm. Wilhelm II. wollte keine starken Persönlichkeiten wie Bismarck oder Caprivi. Der Kaiser versuchte in den Neunzigerjahren einen „populären Absolutismus“ zu verankern (Clark 2019, S. 124).
Wilhelm II. hielt an seinen monarchischen Vorrechten fest (vgl. Mommsen 2005, S. 259). Aus seinen autokratischen Neigungen machte er keinen Hehl:
„Ich kenne keine Verfassung. Ich kenne nur das, was Ich will“ (Röhl 2001, S. 935).
Mitte der Neunzigerjahre wollte er mit Ausnahmegesetzen gegen die Sozialdemokratie vorgehen, aber die „Umsturzvorlage“ scheiterte im Reichstag. Der Kaiser soll an einen Staatsstreich gedacht haben. 1896/97 wurde von Militärs, die das Ohr des Staatsoberhauptes besaßen, über eine „große Abrechnung“ mit den Sozialisten nachgedacht (zitiert nach Ziekursch 1930, S. 82). Der Reichskanzler erteilte diesen Plänen eine Absage (vgl. Hartau 1984, S. 55).
Dies bedeutete aber nicht, dass der Monarch sich auf die Konservativen stützen wollte. Er hoffte auf eine „nationale Mitte“, die seine Industriepolitik und seine Flottenbaupläne unterstützte (Clark 2019, S. 142). In der Schul- und Hochschulpolitik machte er den Weg frei für notwendige Reformen. Diese spannungsgeladene Mischung aus Modernität und Reaktion fiel schon Zeitgenossen auf. Theodor Fontane schrieb im April 1897 einem Freund: „Was mir an dem Kaiser gefällt, ist der totale Bruch mit dem Alten und was mir an dem Kaiser nicht gefällt, ist das im Widerspruch dazu stehende Wiederherstellenwollen des Uralten“ (zitiert nach Craig, 1985, S. 82).
Zeitgenössische Kritiker bezeichneten den Regierungsstil als „Persönliches Regiment“, dass der Monarch und seine Berater am Reichskanzler und dem Reichstag vorbei etablieren wollten. Wilhelm II. hatte seinen sprunghaften Arbeitsstil und seine Neigung zu vorschnellen Urteilen nicht abgelegt. Christopher Clark spricht in seiner Studie über den letzten deutschen Monarchen von einer „seltsamen Mischung aus Abwesenheit und periodischen Einmischungen, aus Lethargie und unvermittelten Eruptionen von Tatendrang“ (Clark 2019, S. 126). Ebenso fatal war seine Neigung, öffentliche Reden zu halten, in denen sein autoritäres Amtsverständnis zum Ausdruck kam.
Im Reichstag und in der höheren Beamtenschaft wuchs die Kritik an Wilhelm II. (vgl. Mommsen 2005, S. 74). Am 18. Mai 1897 debattierte das Parlament über dieses Thema. Der linksliberale Abgeordnete Eugen Richter fand deutliche Worte: „Wo ist denn heute ein einheitlicher, zielbewusster Wille, der nicht von plötzlichen Impulsen getragen wird, sondern der mit Umsicht und Einsicht stetig ein Ziel zu verfolgen weiß? (Sehr gut! links, Anmerkung der Reichstagstenografen, die Verfasserin)“ (zitiert nach Ritter 1981, S. 314). Der freisinnige Abgeordnete war besorgt über den Ansehensverlust der Krone seit 1888. Er befürwortete eine konstitutionelle Monarchie. Der Herrschaftsstil des Kaisers gefährdete in seinen Augen die Stabilität des noch jungen Kaiserreiches.
Nach außen stand Deutschland am Ende des Jahrhunderts gut da. Das Land zählte nun zu den großen Industrienationen. Der Kaiser förderte diese Entwicklung (vgl. Nonn 2020, S. 305). Deutsche Produkte machten auf den Weltmärkten England Konkurrenz. In Wissenschaft und Forschung nahm das Kaiserreich eine Spitzenstellung ein. Auch in der staatlichen Sozialpolitik ging Deutschland voran. Die Lebensverhältnisse der Industriearbeiterschaft verbesserten sich zum Teil deutlich (vgl. Mann 1976, S. 498). Doch die vermeintlich starke Position des Reiches führte zu außenpolitischen Fehlentscheidungen.
Weltpolitik und Flottenbau
1897 berief Wilhelm II. zwei Männer in die Regierung, die die Politik des Kaiserreiches nachdrücklich prägen sollten. Der Diplomat Bernhard von Bülow ersetzte Marschall von Bieberstein im Auswärtigen Amt und Konteradmiral Alfred Tirpitz avancierte zum Staatssekretär im Reichsmarineamt. Bülow galt als designierter Nachfolger des greisen Reichskanzlers. Drei Jahre später konnte Hohenlohe-Schillingsfürst ihm die Amtsgeschäfte übergeben.
Bülow und Tirpitz sollten die Pläne des Monarchen für den Bau einer mächtigen Hochseeflotte umsetzen. Wilhelm II. war davon überzeugt, dass eine Großmacht nicht nur über ein starkes Heer, sondern auch über eine mächtige Marine verfügen müsse (Die deutsch-englische Flottenrivalität — Dr. Katharina Kellmann (katharinakellmann-historikerin.de). Als England am 30. Juni 1897 den deutsch-englischen Handelsvertrag aufkündigte, war für den Monarchen klar: „Hätten wir eine starke, achtunggebietende Flotte gehabt, wäre Kündigung nicht erfolgt; als Antwort muß eine schleunige, bedeutende Vermehrung unserer Neubauten ins Auge gefaßt werden“ (zitiert nach Ziekursch 1930, S. 113).
Seit 1888 hatte der Kaiser den Ausbau der Flotte gefordert (vgl. Schüssler 1962, S. 58). Bis dahin sollte die Marine lediglich die Küste schützen. Wilhelm II. sah in ihr ein strategisches Instrument. Zuerst hatten er und hohe Marineoffiziere an eine Kreuzerflotte gedacht, die in Übersee die Rechte von Auslandsdeutschen wahren sollte. Konteradmiral Tirpitz vertrat hingegen das Konzept einer Schlachtflotte mit dem Schwerpunkt in der Nordsee(). Die schwerbewaffneten Schiffe mit begrenztem Aktionsradius sollten den „Bündniswert“ Deutschlands gegenüber England erhöhen.

Auch innenpolitisch verfolgten Bülow und Tirpitz mit dem Schlachtflottenbau ein Ziel. Sie strebten die Bildung eines liberal-konservativen Blocks an. Das Industriebürgertum und die Agrarier sollten ein gesellschaftliches Bündnis gegen die Arbeiterbewegung bilden. Eine expansive Außenpolitik kam den Wünschen vieler Liberaler entgegen und würde systemstabilisierend wirken – ein Argument, mit dem die Reichsführung die Bedenken der Konservativen überwand (vgl. Nonn 2020, S. 343). Tirpitz bemühte sich außerdem um das Zentrum, dessen Stimmen im Reichstag für die Verabschiedung der Flottenbaugesetze entscheidend waren. Nur die Sozialdemokraten und ein Teil der Linksliberalen sprachen sich gegen die maritime Aufrüstung aus. Dem ersten Flottenbaugesetz von 1898 folgte schon zwei Jahre später ein weiteres Gesetz, dessen Ziel der Aufbau einer Marine war, mit der Deutschland zur zweitgrößten Seemacht nach England aufsteigen sollte.
England und Frankreich schlossen 1904 einen Bündnisvertrag ab, um kolonialpolitische Streitigkeiten beizulegen. An der Themse orientierte man sich um die Jahrhundertwende wieder nach Europa und suchte Verbündete auf dem Kontinent. Der Flottenbau war nicht ursächlich für die britische Neuorientierung. Rainer F. Schmidt fasste in seinem Buch „Kaiserdämmerung“ die Gründe für die außenpolitische Linie Londons zusammen:
„Vor allem war es keineswegs die allenthalben beschworene ‚deutsche Gefahr‘ , die für die konzeptionelle Neuausrichtung der Londoner Politik verantwortlich und ursächlich war. Entscheidend waren Faktoren, die mit der Flotte nichts und mit dem Deutschen Reich nur indirekt zu tun hatten: der pro-französische und pro-russische Kurs führender Politiker, die spezifische Konstellation in der seit Ende 1905 amtierenden liberalen Regierungspartei sowie der Aufrüstungsbestrebungen von Armee und Marine.“ (Schmidt 2021, S. 416)
Die Notwendigkeit, den Druck auf das Empire zu lockern, legte die Annäherung an Frankreich und Russland nahe. Aber das zweite Flottengesetz führte dazu, dass sich die Beziehungen zwischen England und Deutschland verschlechterten (vgl. Massie 1993, S. 211)). Zwei weitere Flottennovellen 1906 und 1908 vergrößerten die deutsche Marine und steigerten das Bautempo. Der Ausbildungsstand und die Qualität der Schiffe sorgten in der Royal Navy für Besorgnisse (vgl. Massie 1993, S. 210).
Welchen Anteil hatte der Kaiser an dieser Entwicklung? Wilhelm II. wollte keinen Krieg gegen England. Bei einem Staatsbesuch im November 1907 sagte er in London: „Die Hauptstütze und Grundlage des Friedens in der Welt ist die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern, und ich werde sie weiterhin stärken, soweit das in meiner Macht liegt“ (zitiert nach Balfour 1973, S. 297). Aber er lehnte jedes Zugeständnis in der Flottenfrage ab. Im Februar 1908 rechtfertigte er seinen Standpunkt in einem Privatbrief an Lord Tweedmouth:
„Die deutsche Flotte ist schlechthin gegen niemanden gebaut. Sie ist lediglich gebaut für Deutschlands Bedürfnisse im Verhältnis zu einem schnell wachsenden Handel … Dieses ewige Zitieren der ‚deutschen Gefahr‘ ist höchst unwürdig der großen britischen Nation und ihres weltweiten Imperiums und ihrer mächtigen Marine, die etwa fünfmal so groß wie die deutsche Marine ist“ (zitiert nach Balfour 1973, S. 302).
Hinzu kam eine Neuorientierung in der deutschen Außenpolitik, die von Zeitgenossen und Historikern „Weltpolitik“ genannt worden ist. Kolonien hatte Deutschland schon unter Bismarck erworben. In erster Linie verfolgte das Kaiserreich damals aber das Ziel, seine Position in Europa zu festigen. Hinter dem Schlagwort „Weltpolitik“ verbarg sich der Anspruch, dass in Zukunft auch in Übersee Deutschland den Anspruch erhob, als gleichberechtigte Großmacht gehört zu werden. In der ersten Marokkokrise 1905 zeigte Berlin, was man darunter verstand. Es ging um Einflusssphären im Sultanat Marokko. Deutschland wehrte sich dagegen, dass Frankreich mit Unterstützung Englands seinen politischen und wirtschaftlichen Einfluss in dem nordafrikanischen Staat ausbauen wollte. Dabei drohte Berlin mit Krieg. Eine internationale Konferenz, die auf Drängen Deutschlands in Algeciras zusammentrat, endete mit einer diplomatischen Niederlage des Kaiserreiches. Paris knüpfte noch engere Beziehungen zu London.
Wie der Reichskanzler überschätzte Wilhelm II. den Spielraum, den das Deutsche Reich auf der internationalen Ebene besaß. Die Deutschen wurden in Europa als Unruhestifter wahrgenommen (vgl. Köhler, Stuttgart, Leipzig 2002, S. 60). Das Bündnis mit Österreich-Ungarn belastete ebenfalls die deutsche Außenpolitik, denn jede Krise im Verhältnis Wien – Sankt Petersburg führte zu Spannungen in den deutsch-russischen Beziehungen. Im Juli 1905 versuchte Wilhelm II. den russischen Zaren bei einem Treffen in Björkö zu einem deutsch-russischen Defensivbündnis zu überreden. Nikolaus II. unterschrieb einen Vertragsentwurf, aber Reichskanzler Bülow lehnte es mit Rücksicht auf Österreich ab, das Projekt weiter zu verfolgen. Die Berater des Zaren erkannten, dass Russland damit gegen das Bündnis mit Frankreich verstoßen hätte. 1907 einigten sich London und Sankt Petersburg über ihre Ansprüche in Persien. Das Zarenreich trat dem englisch-französischen Bündnis bei. In Berlin sprach man von „Einkreisung“.
Die Daily-Telegraf-Affäre
Wilhelm II. hoffte weiterhin auf eine Einigung mit England. Am 28. Oktober 1908 erschien in der Tageszeitung „Daily Telegraf“ ein Artikel, der auf Gespräche zurückging, die der Kaiser im Herbst 1907 mit einem englischen Freund geführt hatte. Der Monarch behauptete darin, er hätte im Burenkrieg den Engländern einen Feldzugsplan geschickt. Überhaupt sei er ein Freund der Briten im Gegensatz zu den meisten seiner Landsleute. Die deutsche Flotte sollte notfalls gegen die Japaner eingesetzt werden (vgl. Schüssler 1962, S. 78).
Der Kaiser hatte den Artikel dem Reichskanzler zur Gegenzeichnung vorgelegt, wie die Verfassung es vorschrieb. Dieser scheint das Manuskript nur überflogen zu haben und reichte es an das Auswärtige Amt weiter, wo ein Beamter kleinere Korrekturen vornahm. Bülow übernahm die Veränderungen und gab seine Zustimmung.
Die Veröffentlichung sorgte Anfang November für einen Aufschrei der Empörung in Deutschland. Die Konservativen verlangten vom Kaiser, sich in Zukunft unbedachter Äußerungen zu enthalten. Im Reichstag kritisierten Vertreter fast aller Parteien den Monarchen. Aber ihre Vorwürfe richteten sich nicht gegen den Flottenbau. Die Debatte zeigte, dass die „Weltpolitik“ nur von den Sozialdemokraten energisch abgelehnt wurde. Reichskanzler Bülow, der mit seiner Unterschrift die Krise erst möglich gemacht hatte, distanzierte sich vom Kaiser (Die Daily-Telegraph-Affäre — Dr. Katharina Kellmann (katharinakellmann-historikerin.de).
Wilhelm II. soll an Rücktritt gedacht haben und erlitt einen Zusammenbruch. Er musste eine Erklärung unterzeichnen, in der er für die Zukunft mehr Zurückhaltung versprach. Im Sommer 1909 entließ er von Bülow und ernannte den Staatssekretär im Reichsamt des Innern, Theobald von Bethmann-Hollweg, zum Nachfolger.
Bethmann hatte als Jurist in der Verwaltung Karriere gemacht. Von Außenpolitik verstand er wenig. Er hatte allerdings erkannt, dass die außenpolitische Situation des Reiches schwierig war. Der Reichskanzler wollte das Verhältnis zu England verbessern und trat für Zugeständnisse in der Flottenrüstung ein. Dabei stieß er auf den entschiedenen Widerstand von Admiral von Tirpitz. Der Staatssekretär im Reichsmarineamt zog aus dem immer enger werdenden Bündnis zwischen Frankreich, Russland und England eine andere Konsequenz: In seinen Augen sollten mehr Schiffe gebaut werden. Tirpitz war davon überzeugt, dass London schließlich auf Berlin zugehen müsste.
1911 endet auch die zweite Krise um das Sultanat Marokko mit einer diplomatischen Niederlage (Deutsche Außenpolitik ohne Konzept — Dr. Katharina Kellmann (katharinakellmann-historikerin.de). Wieder hatte sich London an die Seite von Paris gestellt. Tirpitz setzte bei Wilhelm II. eine neue Flottennovelle durch. In England gab es aber immer noch Kräfte, die auf eine Entspannung hofften. Zu ihnen gehörte Heeresminister Haldane. Haldane hatte in Göttingen studiert und besuchte 1912 privat Deutschland. In Berlin führte er Gespräche mit Bethmann-Hollweg, dem Kaiser und Tirpitz. Wilhelm II. war nach der Abreise von Haldane der Überzeugung, dass eine Verständigung ohne nennenswerte Zugeständnisse beim Flottenbau möglich wäre (vgl. Röhl 2008, S. 904). In England sah man dagegen keine Veranlassung, die Sondierungen fortzusetzen. Die von Deutschland geforderte Neutralität in einem Krieg auf dem Kontinent lag nicht im Interesse Londons, zumal die angebotenen Zugeständnisse nicht ausreichten. Zwischen 1912 und 1914 gelang es Bethmann, die deutsche Außenpolitik in ruhigere Bahnen zu lenken. Die deutsche Rüstung konzentrierte sich wieder stärker auf das Heer.
1913 beging der Kaiser sein 25-jähriges Thronjubiläum. In der Bevölkerung war der Monarch beliebt. Wilhelm II. spielte immer noch eine politische Rolle, aber von einem „persönlichen Regiment“ konnte keine Rede mehr sein. In den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Eliten blieb er umstritten. Wäre seine Herrschaft in diesem Jahr zu Ende gegangen, so wäre er als der Kaiser in die Geschichte eingegangen, unter dem Deutschland trotz innerer Spannungen seinen Durchbruch als Industrienation erlebte hätte. Vielen Menschen ging es besser als im Jahr seiner Thronbesteigung. Die innenpolitische Entwicklung am Vorabend des Ersten Weltkriegs stagnierte, aber unregierbar war Deutschland nicht (vgl. Nipperdey, 1995, S. 755).
Außenpolitisch stand das Reich scheinbar mächtiger da als 1888. Es verfügte über eine starke Hochseeflotte und ein größeres Kolonialreich als noch unter seinem Großvater. Die Allianz zwischen Frankreich, Russland und England festigte sich, aber in Berlin und London verhandelte man über strittige Kolonialfragen und blieb damit im Gespräch. Wilhelm II. hätte seinem Nachfolger 1913 ein respektables, aber nicht unbedingt einfaches Erbe hinterlassen (vgl. Köhler 2002, S. 55).
Weltkrieg
Nach dem Ersten Weltkrieg wollten die Siegermächte den Kaiser vor ein internationales Gericht stellen (vgl. Clark 2019, S. 322). In der alliierten Propaganda wurde er für den Ausbruch des Krieges verantwortlich gemacht. Historiker diskutieren heute immer noch über den Anteil, den die deutsche Politik – und damit auch der Kaiser – an den Ereignissen im Juli 1914 hatte.
Am 28. Juni 1914 wurde der Kronprinz von Österreich-Ungarn in Sarajewo von serbischen Nationalisten ermordet. Der deutsche Botschafter in Wien informierte am 2. Juli 1914 Berlin darüber, dass das Attentat in Belgrad, der Hauptstadt des Königreiches Serbien, geplant worden wäre. Wilhelm soll daraufhin eine ‚Abrechnung‘ mit Serbien gefordert haben, was von einigen Historikern in Deutschland als Bereitschaft zum Krieg interpretiert wurde. Da Russland ein enger Verbündeter Serbiens war, bestand die Gefahr, dass sich der Konflikt zu einem europäischen Krieg ausweiten könnte, denn auch Berlin war Wien gegenüber zu Beistand verpflichtet. Am 5. Juli 1914 unterrichtete Kaiser Franz-Joseph seinen Verbündeten über die Absicht, den Serben ein scharfes Ultimatum zu stellen, was die deutsche Regierung grundsätzlich befürwortete. Auch darüber gibt es strittige Deutungen. Hatte das Kaiserreich dem Verbündeten einen „Blankoscheck“ ausgestellt und damit den Kriegsausbruch beschleunigt? Bethmann-Hollweg und die Militärs hielten einen Krieg mit Russland für unausweichlich. Eine Demütigung Österreichs wollte man in Berlin nicht hinnehmen. Wilhelm II. verhielt sich in diesen Wochen eher zögerlich und zaudernd – wie in fast jeder Krisensituation. Als Reichsmonarch trägt er aber die Verantwortung für die „waghalsige deutsche Politik“ im Juli 1914 (vgl. Röhl 2018, S. 1147). Ob die deutsche Führung bewusst einen Krieg herbeiführen wollte, wird immer ein Diskussionsthema bleiben.
Als Staatsoberhaupt war Wilhelm II. der Oberste Befehlshaber der Streitkräfte. Doch ihm war bewusst, dass er dafür nicht die erforderlichen Fähigkeiten mitbrachte und überließ die Führung des Krieges den Militärs. Er begab sich aber am 16. August 1914 in das Hauptquartier der Obersten Heeresleitung, wo Adjutanten mit ihm Ausflüge in die Natur machten oder Skat spielten. Bei Siegesmeldungen neigte er zum Überschwang, bei schlechten Nachrichten verfiel er in übertriebenen Pessimismus (vgl. Balfour 1973, S. 389). Reisen an die Front endeten in den Hauptquartieren der Generäle weit hinter dem Schützengraben (vgl. Röhl 2008, S. 1203). Von der Stimmung im Heimatkriegsgebiet, die immer schlechter wurde, bekam er nichts mit.
Wilhelm II. war aber nicht bedeutungslos geworden, wie manche Historiker meinen. Wichtige Entscheidungen gingen weiter über seinen Schreibtisch. Als 1917 Forderungen nach einer Parlamentarisierung des Reiches und einem Frieden ohne Annexionen und Gebietserwerbungen im lauter wurden, hätte der Monarch noch einmal eine politische Rolle spielen können. Den Forderungen nach einer Demokratisierung der Reichsverfassung erteilte er eine Absage. Als ihm am 20. Juli 1917 Parlamentarier der SPD, des Zentrums und der Fortschrittlichen Volkspartei vorgestellt wurden, ließ er sie wissen:
„Wo die Garde auftritt, gibt es keine Demokratie“ (zitiert nach Payer 1923, S. 179).
Die Militärs drängten den Kaiser schließlich am 29. September 1918 zu einer Parlamentarisierung des Reiches, weil sie nicht die Verantwortung für die Folgen der Niederlage übernehmen wollten. Seinen Thron konnte er damit nicht retten. Immer mehr Menschen waren davon überzeugt, ohne einen Hohenzollern an der Spitze des Staates würde Deutschland einen milderen Frieden erhalten. In den Mittagsstunden des 9. November 1918 gab der letzte kaiserliche Reichskanzler die Abdankung des Monarchen bekannt, der sich seit Ende Oktober im Hauptquartier der Obersten Heeresleitung in Spa aufhielt. Am nächsten Morgen überschritt Wilhelm II. die niederländische Grenze und bat um Asyl (Das Ende der Hohenzollernmonarchie — Dr. Katharina Kellmann (katharinakellmann-historikerin.de).
Wilhelm II. und seine Verantwortung
Die Jahre zwischen 1890 und 1918 werden oft als „Wilhelminisches Zeitalter“ bezeichnet, ein Beleg dafür, dass dieser Fürst seiner Zeit seinen Stempel aufdrückte (vgl. Köhler 2002, S. 30).
Trotzdem kann das Urteil über den letzten deutschen Kaiser nicht günstig ausfallen. Dabei schien er zu Beginn seiner Herrschaft das wichtigste Problem erkannt zu haben. Er zeigte viel Verständnis für das harte Los der Arbeiterschaft – von den allermeisten europäischen Herrschern konnte man das nicht behaupten. Aber auch hier erwies sich, dass der Monarch die Zeichen der Zeit nicht verstanden hatte: Ein ’soziales Königtum‘ konnte im 20. Jahrhundert nicht mehr mit einem fürsorglichen Sozialkonservatismus die Arbeiterschaft in den Staat integrieren. Hier hätte es zusätzlich demokratischer Reformen bedurft. Dazu war der Kaiser nicht bereit. Im Schul- und Hochschulbereich regte er dagegen wichtige Veränderungen an und setzte sich für eine Aufwertung der technischen Bildung ein (vgl. Nonn 2020, S. 305).

In der Außenpolitik gab es keine klare Linie – außer dem Flottenbau, den er nachdrücklich unterstützte (vgl. Balfour 1973, S. 472). Linksliberale, Nationalliberale, das Zentrum und die Konservativen befürworteten den Kurs des Kaisers. Sie kritisierten unbedachte Äußerungen des Monarchen, waren aber davon überzeugt, dass die maritime Aufrüstung zum Schutze des eigenen Handels erforderlich ist. Christopher Clark kommt in seiner Studie über den letzten deutschen Kaiser zu dem Ergebnis, dass sein Einfluss nicht so groß gewesen wäre, dass er die deutsche Diplomatie bestimmt hätte (vgl. Clark 2019, S. 337).
Dass Wilhelm II. dem Amt nicht gewachsen war, musste nicht zum Zusammenbruch der Monarchien in Deutschland im Herbst 1918 führen. Die Fehler des Monarchen waren typisch für die politischen Eliten des Kaiserreiches, den Adel und das Bürgertum. Als Beispiel sei der Flottenbau erwähnt. Viele Diplomaten und Angehörige des Reichstages konnten sich nicht in die Lage Englands versetzen. Dort wurde die deutsche Marine als Bedrohung empfunden. Das Kalkül von Admiral Tirpitz, London würde auf Berlin zugehen, erwies sich spätestens 1908 als gescheitert. Trotzdem hielt man an der maritimen Aufrüstung fest und investierte große Summen, die besser dem Heer zugutegekommen wären. Man vernachlässigte deutsche Sicherheitsinteressen und ließ sich auf einen Rüstungswettlauf ein, den das Kaiserreich politisch schon vor 1914 verloren hatte.
Michael Balfour kommt in seiner immer noch lesenswerten Biografie über den Monarchen zu dem Schluss, dass dem Kaiser viele Eigenschaften fehlten, die einen Politiker und Staatsmann auszeichnen. Wilhelm wäre zu sprunghaft gewesen und hätte seine Minister behindert, statt konstruktiv mit ihnen zusammen zu arbeiten. Trotz seiner martialischen Worte wäre er gar nicht in der Lage gewesen, das Amt eines Reichsmonarchen auszufüllen:
„In der Stellung, die er einnahm, hätte er vieles tun können, um den in seiner Umgebung wirkenden Tendenzen entgegenzuwirken, statt dessen verlieh er ihnen gesteigerten Nachdruck. Während er für sich eine Führerrolle in Anspruch nahm, folgte er tatsächlich anderen und ließ sich durch seine Umgebung formen, anstatt sie durch seine Persönlichkeit zu prägen. Er hätte es sehr ungern gehört, aber er war ein bourgeoiser Monarch nach den Begriffen des deutschen Bürgertums. Er verkörperte die Schwächen des deutschen Mittelstandes, übernahm kritiklos die Traditionen der preußischen Großgrundbesitzer und suchte, sie in einer Situation in die Tat umzusetzen, der sie nicht mehr gewachsen waren. Aus Angst, nicht das Maß zu erreichen, das man von ihm erwartete, verfiel er in Übertreibung“ (Balfour 1973, S. 473).
Selbst wenn Wilhelm II. und die deutschen Fürsten klug genug gewesen wären und auf einen Teil ihrer Macht verzichtet hätten, wäre eine parlamentarische Monarchie zwischen 1890 und 1918 möglich gewesen? Diese Staats- und Regierungsform setzt nicht nur einen Monarchen voraus, der sich aus der Tagespolitik heraushält und neutral bleibt. Voraussetzung ist ebenfalls, dass es politische Kräfte gibt, die in der Volksvertretung eine Regierung tragen. Zwischen 1906 und 1909 kam es im Reichstag zu einer Zusammenarbeit zwischen den Konservativen, den Nationalliberalen und den Linksliberalen, dem „Bülow-Block“. Nach der Reichstagswahl 1912 hätte sich ein Bündnis der Sozialdemokraten mit den Liberalen angeboten, aber die inhaltlichen Differenzen waren zu groß. Die deutschen Parteien in der Mitte und auf der Rechten konzentrierten sich darauf, für ihre Wähler möglichst viele Zugeständnisse herauszuholen. Die Sozialdemokraten waren in mehrere Flügel zerfallen und verblieben in einer Daueropposition, was die Zustimmung zu einzelnen Gesetzen nicht ausschloss. Nur ein kleiner Teil befürwortete die Zusammenarbeit mit fortschrittlichen bürgerlichen Kräften.
Erst 1917 fand sich im Reichstag eine Mehrheit, bestehend aus den Sozialdemokraten, dem Zentrum und der linksliberalen Fortschrittlichen Volkspartei, die eine Parlamentarisierung der Monarchie forderte. Ob diese innenpolitische Neuorientierung 1918 in der Niederlage Bestand gehabt hätte, ist zweifelhaft. Erst auf Druck der Militärs war Wilhelm II. zu diesem Schritt bereit, aber zu diesem Zeitpunkt hatte eine parlamentarische Monarchie keine Chance mehr.
Nur wenige Politiker oder Fürsten waren im Exil in der Lage, das eigene Tun selbstkritisch zu reflektieren. Auch Wilhelm II. gehörte nicht dazu. Mal waren es die Juden, mal die Sozialisten oder die Freimaurer, die ihn um seine Krone gebracht hätten (vgl. Röhl 2008, S. 1289; Clark 2019, S. 329). Zu Beginn der Dreißigerjahre scheint er Sympathien für den Nationalsozialismus empfunden zu haben, weil er sich davon die Rückkehr auf den Thron erhoffte (vgl. Röhl 2008, S. 1304). Doch Hitler dachte nicht an eine Restauration der Monarchie. Wilhelm II. spielte in der deutschen Politik keine Rolle mehr.
Am 4. Juni 1941 starb der letzte deutsche Kaiser in Doorn im Exil, wo er heute noch begraben liegt.
Weiterführende Informationen:
Deutscher Kaiser: Wilhelm II. wurde zum Totengräber der Monarchie – WELT
Literaturliste
Michael Balfour, Der Kaiser. Wilhelm II. und seine Zeit, Berlin 1973
Christopher Clark, Wilhelm II. Die Herrschaft des deutschen Kaisers, 7. Aufl., München 2019
Virginia Cowles, Wilhelm II.. Der letzte deutsche Kaiser, 2. Aufl., Frankfurt/M.
1978
Gordon A. Craig, Das Ende Preußens. Acht Porträts, München 1985
Friedrich Hartau, Wilhelm II., Reinbeck 1984
Henning Köhler, Deutschland auf dem Weg zu sich selbst. Eine Jahrhundertgeschichte, Stuttgart, Leipzig 2002
Christoph Nonn, 12 Tage und ein halbes Jahrhundert. Eine Geschichte des Deutschen Kaiserreiches 1871 – 1918, München 2020
Robert K. Massie, Großbritannien, Deutschland und das Heraufziehen des Ersten Weltkriegs, Frankfurt/M. 1993
Golo Mann, Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, 11. Aufl., Frankfurt/M. 1976
Wolfgang J. Mommsen, War der Kaiser an allem schuld? Wilhelm II. und die preußisch-deutschen Machteliten, Berlin 2005
Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte, Band II: Machtstaat vor der Demokratie, 3. durchgesehene Aufl., München 1995
Friedrich von Payer, Von Bethmann-Hollweg bis Ebert. Erinnerungen und Bilder, Frankfurt/M. 1923
John C. G. Röhl, Wilhelm II. Der Aufbau der persönlichen Monarchie, München 2001
John C. G. Röhl, Wilhelm II. Der Weg in den Abgrund 1900 – 1941, München 2008
Rainer F. Schmidt, Kaiserdämmerung. Berlin, London, Paris, St. Petersburg und der Weg in den Untergang, Stuttgart 2021
Wilhelm Schüssler, Kaiser Wilhelm II. Schicksal und Schuld, 2. Aufl., Berlin, Frankfurt, Zürich 1962
Michael Stürmer, Das ruhelose Reich. Deutschland 1866 – 1918, Darmstadt 1983
Tyler Whittle, Kaiser Wilhelm II. Ein Monarch, der geliebt werden wollte, Bergisch-Gladbach 1982
Johannes Ziekursch, Das Zeitalter Wilhelms II., Frankfurt/M. 1930

