Am 6. Februar 1919 trat in Weimar die Nationalversammlung zusammen. Sie musste nicht nur eine neue Verfassung beschließen, sondern sich auch um einen Friedensvertrag bemühen. Die Sozialdemokraten bildeten mit dem Zentrum und der DDP eine Regierung. Die Abgeordneten wählten Friedrich Ebert zum Reichspräsidenten. Seine Amtszeit sollte bis 1922 dauern.
Reichsministerpräsident wurde Philipp Scheidemann von der SPD. Das wichtige Außenministerium führte Ulrich Graf Brockdorff-Rantzau, ein liberaler Aristokrat, der als Berufsdiplomat im Kaiserreich Karriere gemacht hatte. Brockdorff bestimmte den Kurs der deutschen Außenpolitik in der ersten Jahreshälfte maßgeblich (Gupp in Bracher/Funke/Jacobsen 1987, S. 295). Die Waffenstillstandsverhandlungen wurden dagegen von dem Zentrumspolitiker Matthias Erzberger geführt. Zwischen beiden Männern gab es Meinungsverschiedenheiten. Erzberger wollte den Siegermächten notfalls auch entgegenkommen, während Brockdorff eine starre Linie verfolgte, die bei den Alliierten manchmal für Misstrauen sorgte (vgl. Büttner 2010, S. 351).
In diesem Kapitel geht es um das Ringen um einen annehmbaren Frieden. In Deutschland war man sich darüber im Klaren, dass die Handlungsmöglichkeiten der jungen deutschen Demokratie sehr stark von den Auswirkungen des Friedens abhängen würden (vgl. Dok. 164 in ADAP, Göttingen 1982, S. 279). Deshalb sollen hier Fragen der Außenpolitik im Vordergrund stehen.

Hoffnungen auf einen „billigen und gerechten Frieden“
Von Anfang an beschäftigte der kommende Friedensvertrag die Bevölkerung und die Abgeordneten in Weimar. Graf Brockdorff-Rantzau hatte im Januar 1919 in einem Vermerk die über die Möglichkeiten der deutschen Außenpolitik nachgedacht. Brockdorff war sich darüber im Klaren, dass Deutschland im Augenblick weder über die politischen noch die wirtschaftlichen Mittel verfügte, um eine aktive Außenpolitik zu betreiben (vgl. Dok. 116 in ADAP 1982, S. 204). Er hoffte, dass die Siegermächte erkennen würden, dass ein stabiles Deutschland in ihrem Interesse wäre. Dieses Deutsche Reich solle den Westmächten als strategisches Vorfeld gegenüber der Sowjetunion dienen (vgl. Dok. 116 in ADAP 1982, S. 205). Deshalb müsse man sich mit den Siegerstaaten auf zwei Punkte verständigen: Eine gemeinsame antikommunistische Außenpolitik und als Voraussetzung dafür die Gewährung eines „billigen und gerechten Friedens“ für Deutschland (Dok. 116 in ADAP 1982, S. 207).
Wie dieser Frieden aussehen sollte, sagte Brockdorff nicht. Doch es war klar, dass Deutschland keine eigenständige Außenpolitik mehr treiben konnte. In Berlin war man auf das Entgegenkommen von Paris, London und Washington angewiesen. Doch schon die Waffenstillstandsbedingungen vom 11. November 1918 fielen sehr hart aus. 5000 Geschütze, 5000 Lokomotiven, 150 000 Waggons und 1700 Flugzeuge mussten sofort ausgeliefert werden. Die linksrheinischen Gebiete des Reiches wurden von den Alliierten besetzt. Unter Aufsicht der Siegermächte sollte die deutsche Verwaltung weiter arbeiten. Entlang des rechten Ufers sollte eine neutrale Zone von 10 Kilometern geschaffen werden (vgl. Dok. 487 in Ursachen und Folgen Band 3 1959, S. 483). Die Hochseeflotte wurde im englischen Flottenstützpunkt Scapa Flow interniert. Die deutschen Kolonien wurden von den Alliierten besetzt (vgl. MacMillan 2015, S. 77).
Im französischen Außenministerium forderten die Diplomaten am 25. Oktober 1918, die deutsche Reichsgründung von 1871 wieder rückgängig zu machen (vgl. Hildebrand 1996, S. 390). In Paris wusste man, dass der Sieg nur mit Unterstützung Englands und der Vereinigten Staaten errungen worden war. Deutschland verfügte über die größere Bevölkerung und die stärkere Wirtschaft. Die französische Außenpolitik wollte verhindern, dass das besiegte Deutschland wieder zu alter Stärke zurückfinden könnte (vgl. MacMillan 2015, S. 64). Marschall Foch, der alliierte Oberbefehlshaber, schlug im Januar 1919 vor, die „militärische Westgrenze der deutschen Völker“ an den Rhein zu verlegen (Dok. 708 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 335). Die linksrheinischen Gebiete sollten nicht annektiert, sondern von den Alliierten besetzt werden. Gleichzeitig wollte Foch diesen Teil des Rheinlandes „durch ein gemeinsames Zollsystem“ an seine westlichen Nachbarn binden (Dok. 708 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 336). Als Fernziel schwebte ihm „gemäß dem allgemein anerkannten Grundsatz der Freiheit der Völker die Bildung neuer unabhängiger Staaten am linken Rheinufer“ vor (Dok. 708 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 336).
Frankreich wollte die Allianz mit England und den Vereinigten Staaten im Frieden aufrecht erhalten (vgl. MacMillan 2015, S. 64). Die gemeinsame unbegrenzte alliierte militärische Kontrolle des Rheinlands, die Foch vorschlug, hätte London und Washington dauerhaft auf dem Kontinent gebunden. Doch England und die Vereinigten Staaten wollten nicht so weit gehen wie Frankreich. Beide Nationen hatten ein Interesse daran, dass Deutschland als Machtfaktor in Europa bestehen blieb (vgl. Hildebrand, 1996, S. 391). Während Paris auf hohe Reparationen angewiesen war, um die Kriegsschäden zu beseitigen und Kredite an die USA zurückzuzahlen, wollten London und Washington die deutsche Wirtschaftskraft stärken (vgl. Büttner 2010, S. 350). Brockdorffs Hoffnungen schienen zumindest in diesem Punkt nicht unberechtigt zu sein.
In der Wilhelmstraße, dem Dienstsitz des Ministers, gab man sich jedoch Illusionen hin. Der englische Premierminister Lloyd George hatte seinen Wahlkampf im Dezember 1918 mit heftigen Angriffen gegen den Kaiser und Deutschland geführt. Mit einem milden Frieden hätte er nicht aus Frankreich zurückkehren können (vgl. Eyck 1959, S. 115). Noch größer waren die Hoffnungen auf eine vermittelnde Rolle der USA (vgl. Krüger, 1973, S. 35). Im Januar 1918 hatte der amerikanische Präsident Woodrow Wilson ein außenpolitisches Programm verkündet, dass u. a. die Räumung der besetzten Gebiete in Frankreich, die Wiederherstellung Belgiens, die Gründung eines polnischen Staates, die Annullierung der deutschen Annexion von Elsass-Lothringen und Vereinbarungen über Rüstungsbegrenzungen vorsah (vgl. Dok. 399 in Ursachen und Folgen, Band 2 1959, S. 374 – 376). Die deutsche Regierung griff diese Vorschläge im Oktober 1918 auf und leitete daraus die Erwartung ab, als besiegte aber im Prinzip gleichberechtigte Großmacht akzeptiert zu werden. Die Bedingungen des Waffenstillstandes überraschten daher die deutsche Seite. Friedrich Ebert, der Vorsitzende des Rats der Volksbeauftragten, meinte dazu am 10. November 1918: „Er müsse aber schon heute betonen, daß von einem Frieden des Rechts und der Gerechtigkeit bei solchen Bedingungen keine Rede mehr sein könne. Die uns auferlegten Opfer seien so unerhört, daß sie zu einer Vernichtung des ganzen Volkes führen müßten“ (zitiert nach Krüger 1973, S. 42).
Als Ebert am 6. Februar 1919 die Weimarer Nationalversammlung eröffnete, sprach er von einem „Wilsonfrieden, auf den wir Anspruch haben“ (Dok. 652 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 249).
Die Suche nach einer angemessenen Strategie für die Teilnahme an der Friedenskonferenz sollte die deutsche Seite in den nächsten Monaten beschäftigen. Doch auch unter den Alliierten gab es keine klaren Konzepte für die Nachkriegszeit. Einig war man sich nur in einem Punkt: Deutschland sollte entschieden in die Schranken verwiesen werden.
Am 12. Januar 1919 begannen in Versailles bei Paris die Beratungen. Der amerikanische Präsident Wilson, Lloyd George, der französische Premierminister Georges Clemenceau und sein italienischer Kollege Orlando bildeten ein Beratungsgremium, zu dem einen Tag später noch zwei japanische Vertreter stießen. Deutschland hatte keine Einladung nach Versailles erhalten, ein „bis dahin im europäischen Völkerrecht gänzlich unbekannter Aspekt der Friedensverhandlungen …“ (Kraus 2013, S. 23).
Die deutschen Vorbereitungen
Am 14. Februar 1919 hielt Außenminister Graff Brockdorff-Rantzau eine Grundsatzrede in der Weimarer Nationalversammlung. Der Graf berief sich erneut auf Wilson und seine 14 Punkte (vgl. Brockdorff-Rantzau, 1920, S. 40). In Anlehnung daran forderte Brockdorff „eine internationale Schiedsgerichtsbarkeit und de(n) Verzicht auf eine Rüstung“ (Brockdorff-Rantzau 1920, S. 40). Der Außenminister leitete aus den Reden des amerikanischen Präsidenten klare Forderungen an die Siegermächte ab: „Deshalb halten wir an den Wilsonschen Grundsätzen fest, daß dem Sieger keine Kriegskosten zu bezahlen und keine Gebiete der Besiegten abzutreten sind“ (Brockdorff-Rantzau 1920, S. 41).
Punkt VIII der 14 Punkte sah ausdrücklich vor, dass die besetzten Teile Frankreichs geräumt und „wiederhergestellt werden“ sollten (Dok. 399 in Ursachen und Folgen, Band 2 1959, S. 375). Das „von Preußen im Jahre 1871 hinsichtlich Elsaß-Lothringens angetane Unrecht … sollte wieder gutgemacht werden, damit erneut Friede im Interesse aller gemacht wurde (Dok. 399 in Ursachen und Folgen, Band 2 1959, S. 375). Das Friedensprogramm des amerikanischen Präsidenten ließ Kriegsentschädigungen zu, wie der amerikanische Außenminister Robert Lansing am 5. November 1918 feststellte (vgl. Dok. 446 in Ursachen und Folgen, Band 2 1959, S. 468). Seit November 1918 lagen der Reichsregierung Informationen über die Möglichkeit hoher Reparationsforderungen vor (vgl. Krueger 1973, S. 52). Auch das Schicksal von Elsaß-Lothringen war entschieden. Bis zum Abschluss eines Friedensvertrages nahm Brockdorff jedoch für das Deutsche Reich in Anspruch, die Interessen der Menschen im Elsaß und Teilen Lothringens zu vertreten. Außerdem ging er davon aus, dass dort eine Volksabstimmung stattfinden müsste (vgl. Brockdorff-Rantzau 1920, S. 46). Brockdorff-Rantzau meinte es Ernst mit dem Versuch, die deutsche Außenpolitik auf neue Grundlagen zu stellen (vgl. Büttner 2010, S. 351). Schon aus wirtschaftlichen Gründen trat er für eine deutliche Reduzierung der deutschen Rüstung ein (vgl. Brockdorff-Rantzau 1920, S. 58).
Die Grundsatzrede unterstrich noch einmal, dass die Wilhelmstraße kaum Möglichkeiten hatte, auf den Ablauf der Friedensverhandlungen einzuwirken. Brockdorff-Rantzau ging bei den 14 Punkten von Woodrow Wilson unrealistischerweise von einem „vereinbarte(n) Friedensprogramm“ aus (Brockdorff-Rantzau 1920, S. 47). Im Auswärtigen Amt wusste man zu diesem Zeitpunkt bereits, „daß ein ultimativer Diktatfrieden zu erwarten sei“ (Krüger 1973, S. 133).
Aus heutiger Sicht mag man darüber den Kopf schütteln, dass sich Deutschland 1919 in der Opferrolle sah. Dass auch das Kaiserreich im Falle eines Sieges wenig Augenmaß und Verständnis für die Besiegten aufgebracht hätte, zeigt ein Blick auf die Kriegszieldiskussion zwischen 1915 und 1918. In Brest-Litowsk zwang Berlin der jungen Sowjetunion einen äußerst harten Frieden auf, der einem Diktat glich und das Reich zu einer Vormacht in Europa erhoben hätte. All dies schienen die führenden Politiker in Weimar aus ihrem Gedächtnis getilgt zu haben, wobei man anmerken muss, dass sich die Regierungsparteien 1917 zu einem Frieden ohne Entschädigungen und Annexionen bekannt hatten, doch die kaiserliche Regierung war dem nicht gefolgt. Auch Brockdorff-Rantzau, im Ersten Weltkrieg Gesandter in Kopenhagen, stand der wilhelminischen Außenpolitik skeptisch gegenüber.
Am 16. Februar 1919 kam endgültig ein unbefristeter Waffenstillstand zustande. Neben den bereits bekannten Bedingungen verhängten die Alliierten weitere Restriktionen. Seit Ende Dezember 1918 kam es in der Provinz Posen, die noch zum Deutschen Reich gehörte, zu Kämpfen zwischen Verbänden der neu gegründeten Republik Polen und deutschen Einheiten. Die Aufständischen übernahmen die Kontrolle. Eine deutsche Gegenoffensive vermochte die polnischen Freischärler zurückzudrängen. Punkt 1 des Waffenstillstandes untersagte dem Deutschen Reich die Weiterführung der Angriffe und legte eine Demarkationslinie fest (vgl. Dok. 710 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 341). Teile der Provinz Polen fielen damit faktisch vor einem Friedensvertrag an die Republik Polen.
Seit Ende November 1918 regte die deutsche Regierung die Einsetzung einer unabhängigen Kommission an, die die Frage der Kriegsschuld klären sollte (vgl. Dok. 706 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 331f.). Die englische Regierung antwortete erst am 7. März 1919 und lehnte es ab, auf den deutschen Vorstoß einzugehen, „da nach Meinung der verbündeten Regierungen die Verantwortlichkeit Deutschlands für den Krieg längst unzweifelhaft festgestellt ist“ (vgl. Dok. 706 a. in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 332). Der Reichsregierung blieb nur ein schwacher Protest (vgl. Dok. 706 b in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 332).
Am 31. März 1919 legte die Wilhelmstraße dem militärischen Berater von Präsident Wilson, General Bliss, eine Ausarbeitung vor, in der sich Brockdorff noch einmal auf die 14 Punkte von Wilson aus dem Januar 1918 berief. An den Friedensverhandlungen sollte Deutschland gleichberechtigt teilnehmen. Eine deutsche Abrüstung wäre nur im Rahmen einer allgemeinen Abrüstung möglich (vgl. Zimmermann 1958, S. 51). Bei Gebietsabtretungen müsse die Bevölkerung vorher gefragt werden. Die Diplomaten rechneten mit dem Verlust von Posen; Oberschlesien und Westpreußen sollten deutsch bleiben. Die Reichsregierung erkannte nun die Verpflichtung an, für die Schäden zu haften, die in Frankreich und Belgien von deutschen Truppen verursacht worden wären (vgl. Zimmermann 1958, S. 52).
Im April teilten die Alliierten der Reichsregierung mit, dass eine deutsche Delegation in Versailles die Friedensbedingungen entgegennehmen sollte (vgl. Eyck 1959, S. 125). Von Verhandlungen war nicht die Rede.
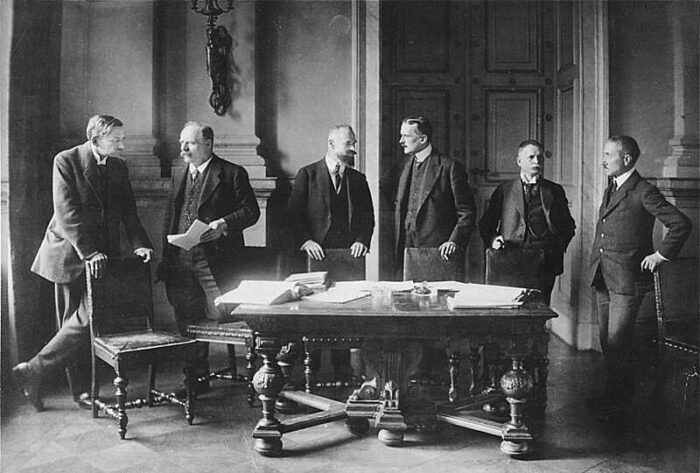
Die alliierten Friedensbedingungen und die deutsche Antwort
Am 7. Mai 1919 wurde den Deutschen im Spiegelsaal von Versailles der Entwurf des Friedensvertrages übergeben. Clemenceau machte in seiner Eröffnungsrede deutlich, dass die Siegermächte für den Sieg große Opfer bringen mussten und deshalb „berechtigte Genugtuung“ verlangen könnten (vgl. Dok. 714 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 346). Der deutschen Delegation wurden vierzehn Tage eingeräumt, um in englischer oder französischer Sprache Gegenvorschläge einzureichen. Mündliche Verhandlungen wurden ausdrücklich abgelehnt (vgl. Dok. 714 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 347).
Graf Brockdorff-Rantzau räumte in seiner Antwort eine deutsche Mitverantwortung am Krieg ein, lehnte aber eine Alleinschuld des deutschen Volkes ab (vgl. Brockdorff-Rantzau 1920, S. 114). Der Außenminister betonte noch einmal die in seinen Augen bindende Wirkung der 14 Punkte von Präsident Wilson und räumte ein, dass Deutschland „schwere nationale und wirtschaftliche Opfer“ zu erbringen hätte (vgl. Brockdorff-Rantzau 1920, S. 116). Brockdorff machte aber auch klar, dass seine Regierung nur einen Frieden unterzeichnen könnte, der erfüllbar wäre.
Die Rede des deutschen Chefdiplomaten rief starke Widerstände hervor. Margaret MacMillan macht nicht so sehr den Inhalt, sondern die Umstände dafür verantwortlich: „Obwohl er viel Versöhnliches sagte, hinterließ er aufgrund der Unfähigkeit seiner Dolmetscher, seines Entschlusses, Sitzen zu bleiben, und seiner scharfen, schnarrenden Stimme einen abstoßenden Eindruck „(MacMillan 2015, S. 607). Wilson und Lloyd George waren empört (vgl. MacMillan 2015, S. 608). Peter Krüger kam 1973 zu dem Urteil: „Am 7. Mai 1919 … hielt er, ein persönlich Getroffener, seine umstrittene Rede und verlor den Tag“ (Krüger 1973, S. 161).
Die Friedensbedingungen fielen härter aus, als in Berlin befürchtet. Elsass-Lothringen ging ohne Abstimmung an Frankreich. Posen, Westpreußen und Oberschlesien sollten Polen zufallen. Danzig sollte den Status einer freien Stadt erhalten; Ostpreußen war vom übrigen Reichsgebiet abgetrennt worden. In den linksrheinischen Gebieten sollten alliierte Truppen stationiert werden – eine Räumung hing davon ab, wie Deutschland die Bedingungen des Friedensvertrages erfüllen würde. Köln und Mainz sollten 15 Jahre lang von den Siegermächten besetzt werden. Das Saarland sollte ebenso lange als Mandatsgebiet des Völkerbunds verwaltet werden. Nach Ablauf dieser Frist durfte die Bevölkerung darüber entscheiden, ob die Saarprovinz Mandatsgebiet bleiben oder in Zukunft zu Frankreich oder zu Deutschland gehören würde. An der deutsch-dänischen Grenze sollte in Nordschleswig ein Referendum stattfinden. Die Stärke des deutschen Heeres wurde auf 100 000 Mann begrenzt. Wehrpflicht und Generalstab mussten abgeschafft werden. Der Marine billigten die Alliierten 15 000 Mann zu. Außerdem sollte im Friedensvertrag die deutsche Kriegsschuld festgeschrieben werden und Deutschland hatte umfangreiche Reparationen leisten, deren Größe offenblieb. Auch die Kolonien waren abzutreten. Dem neu zu gründenden Völkerbund durfte Deutschland nicht angehören.
Frankreich, England und die Vereinigten Staaten hatten sich nur mühsam auf diese Bedingungen einigen können (Michalka in Bracher/Funke/Jacobsen 1987, S. 304). Frankreich forderte einen möglichst harten Frieden für die Nachbarn im Osten. Vier Jahre lang hielten deutsche Truppen Teile des Landes besetzt. Auf ihren Rückzügen hatten die Deutschen Industriebetriebe zerstört, Bergwerke geflutet oder Eisenbahnanlagen unbrauchbar gemacht. Paris verlangte den Ersatz dieser Schäden. Außerdem fürchtete man die Bevölkerungszahl und die überlegene Wirtschaftskraft Berlins. Das Deutsche Reich sollte so stark geschwächt werden, dass in absehbarer Zeit eine militärische Revanche ausgeschlossen wäre. England und die USA lehnten die französische Annexion der deutschen linksrheinischen Gebiete ab. Was die Reparationen anging, so wollten London und Washington auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Deutschen in Rechnung stellen (vgl. MacMillan 2015, S. 261). Gleichzeitig mussten Wilson und Lloyd George auf Stimmungen in ihren Ländern Rücksicht nehmen. Der britische Premierminister hatte mit seinem Wahlkampf 1918 zu dieser Haltung beigetragen. Schließlich einigte man sich im März 1919, keine verbindliche Summe festzulegen, sondern eine Kommission aus Experten einzusetzen (vgl. MacMillan 2015, S. 265).
Je länger die Verhandlungen dauerten, desto größer wurde die Neigung der amerikanischen und englischen Politiker, sich aus der Verantwortung für die Nachkriegsordnung auf dem Kontinent zurückzuziehen. Die französischen Maximalforderungen stießen bei Wilson und Lloyd George zunehmend auf Widerstand. Sie waren an einem geschwächten, aber stabilen Deutschland interessiert. Wilson konnte mit einer amerikanischen Garantie für die französische Sicherheit bei Clemenceau erreichen, dass dieser in eine zeitlich befristete Besetzung des Rheinlandes einwilligte. Der englische Premier stimmte dem Kompromiss am 22. April 1919 zu. Die Bedingungen, die den Deutschen am 7. Mai übergeben werden sollten, empfanden nicht wenige Franzosen als zu milde (vgl. MacMillan 2015, S. 279).
In Deutschland wuchs im Mai die Empörung (vgl. Krüger 1973, S. 162). Nicht nur die rechtsliberale Deutsche Volkspartei oder die rechtskonservative Deutschnationale Volkspartei lehnten den Vertrag ab. Auch Vertreter der Regierungspartei waren entsetzt. „Über den Friedensvertrag will ich schweigen“, schrieb der Linksliberale Friedrich von Payer am 10. Mai 1919 an seine Frau. „Es ist fürchterlich und es mag gehen wie es will, ich wünschte, ich hätte das nicht erleben müssen“ (Nachlass Payer, N 1020/47, Bl. 3). Am 12. Mai 1919 tagte die Weimarer Nationalversammlung in der Aula der Universität Berlin. Reichsministerpräsident Scheidemann fand harte Worte:
„Was soll ein Volk machen, dem das Gebot auferlegt wird: ‚Deutschland ist für alle Verluste, alle Schäden, die die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Nationen infolge des Krieges erlitten, verantwortlich?‘ Was soll ein Volk machen, das bei Festsetzung seiner Verpflichtungen nicht mitreden darf, sondern dem man willig Gelegenheit gibt, sich zu äußern, ohne daß es an den Entscheidungen beteiligt würde?“ (Dok. 715 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 351).
Scheidemann drückte nur aus, was viele Deutsche dachten, als er von „Fesselung und Demütigung und Ausraubung“ sprach (Dok. 715 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 352). Er kritisierte, dass das Reich wie ein Ausgestoßener behandelt wurde. Die angedrohten Reparationen würden den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ruin bedeuten. Zu einem Bruch mit der wilhelminischen Machtpolitik waren die Parteien der Weimarer Koalition bereit. Scheidemann lehnte es jedoch ab, einen Vertrag zu unterschreiben, dessen finanzielle Bedingungen er für unerfüllbar hielt (vgl. Dok. 715 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 352). Wenige Wochen später sollte diese Rhetorik der Regierung schaden, denn sie engte den Handlungsspielraum des Kabinetts ein (vgl. Epstein in Kolb 1972, S. 309). Aus der Perspektive eines Gewerkschafters übte Anton Erkelenz (DDP) am 15. Mai in einem Zeitungsartikel, den er unter der Überschrift „Das Ende des deutschen Volks“ veröffentlichte, Kritik an den Bedingungen: „Da der Schuldendienst an die Feinde vor allen anderen Verpflichtungen geht, werden wir den Kriegsbeschädigten keine Rente, den Inhabern von Kriegsanleihen keine Zinsen zahlen können (Nachlass Erkelenz, N 1072/84, Bl. 103). Der Außenminister betonte am 13. Mai in einem Interview, dass der Vertrag „Unmögliches von Deutschland“ verlangt (Brockdorff 1920, S. 121).
Am 29. Mai 1919 legte der deutsche Außenminister einen Gegenentwurf vor. Brockdorff-Rantzau kritisierte, dass Deutschland Gebiete abtreten sollte, die mehrheitlich von Deutschen bewohnt werden (vgl. Brockdorff-Rantzau 1920, S. 138). Er wehrte sich gegen den Umfang der Reparationsforderungen, die „alle Kriegskosten der Gegner“ abdecken sollten (Brockdorff-Rantzau 1920, S. 138). Gleichzeitig würde man Deutschland daran hindern, seine Wirtschaft wieder aufzubauen. Ohne leistungsfähige Industrie und ohne eine Handelsflotte (die deutschen Handelsschiffe sollten ausgeliefert werden) könnte das Reich die finanziellen Lasten nicht tragen (vgl. Brockdorff-Rantzau 1920, S. 139). Außerdem bemängelte der Diplomat, dass der Vertrag in deutsche Souveränitätsrechte eingreifen würde (vgl. Brockdorff-Rantzau 1920, S. 140).
Wie sahen die deutschen Vorschläge aus? Deutschland wollte die Wehrpflicht aufgeben und seine Streitkräfte auf 100 000 Mann abrüsten. Dafür sollte es als gleichberechtigtes Mitglied in den Völkerbund aufgenommen werden (vgl. Brockdorff-Rantzau 1920, S. 140). Berlin bot auch einen sofortigen Verzicht auf Elsass-Lothringen an, forderte aber eine Volksabstimmung. Der Teil der Provinz Posen, der mehrheitlich von Polen bewohnt wurde, sollte sofort abgetreten werden. Der polnische Staat sollte Freihäfen in Königsberg, Danzig und Memel erhalten. Bis zur Inbetriebnahme der zerstörten französischen Bergwerke würde Frankreich Kohle aus den saarländischen Bergwerken erhalten. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker sollte auch für die Deutschen in Österreich und Böhmen gelten. Die deutschen Kolonien sollten als deutsches Mandatsgebiet dem Völkerbund unterstellt werden. Als Kriegsentschädigung bot Brockdorff den Alliierten 100 Milliarden Mark in Gold an (vgl. Brockdorff-Rantzau 1920, S. 141). Zum Schluss stellte der Außenminister weitere Aufbauhilfen für Belgien und Frankreich in Aussicht. Er wiederholte die Forderung, die Kriegsschuldfrage von einer unabhängigen Kommission klären zu lassen (vgl. Brockdorff-Rantzau 1920, S. 143).
In der französischen Öffentlichkeit herrschte Empörung. In der englischen und amerikanischen Delegation zollte man dem deutschen Vorschlag Respekt. General Henry Wilson, der engste militärische Berater von Lloyd George, schrieb in seinen persönlichen Notizen: „Die Deutschen haben das getan, was ich vorausgesehen hatte: sie haben einen vollständigen Entwurf vorgelegt, der sich auf die Vierzehn Punkte stützt und viel einheitlicher ist als der unsere (zitiert nach MacMillan 2015, S. 612). London war an einem Machtgleichgewicht in Europa interessiert. In den nächsten Tagen kam es im Kreise der Sieger zu erregten Diskussionen. Lloyd George konnte nur durchsetzen, dass in Oberschlesien eine Volksabstimmung stattfinden sollte.
Am 16. Juni 1919 stellten die Alliierten den Deutschen ein Ultimatum (es wurde bis zum 23. Juni verlängert): Innerhalb von fünf Tagen sollten sie unterschreiben – ansonsten würde man die Feindseligkeiten wieder aufnehmen.
Die Annahme des Friedensvertrages
In Weimar lehnten alle Parteien – von der DNVP bis hin zur USPD – den Vertrag ab. Die Kleinstadt in Thüringen erlebte hektische Tage. Die Abgeordneten mussten zwischen den Folgen abwägen, die sich aus der Verweigerung der Unterschrift ergaben und den Konsequenzen, die eintraten, wenn Deutschland in die harten Bedingungen einwilligte. Reichsministerpräsident Scheidemann von der SPD und sein Kabinett traten am 20. Juni 1919 zurück. Auch Graf Brockdorff-Rantzau legte sein Amt nieder, da er die Ratifizierung ablehnte (Brockdorff-Rantzau 1920, S. 183 – 185).
Neuer Regierungschef wurde der Sozialdemokrat Gustav Bauer. Er bildete eine Regierung, die von der SPD und dem Zentrum getragen wurde. Die linksliberale DDP wollte den Vertrag nicht akzeptieren und schied aus dem Kabinett aus. Am 22. Juni 1919 teilte der Reichsministerpräsident den Alliierten mit, dass Deutschland mit Vorbehalt unterschreiben wolle. Die Bestimmungen über die Feststellung der deutschen Kriegsschuld lehnte das neue Kabinett ab (Dok. 726 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 384). Clemenceau wies diesen Vorschlag im Namen der Alliierten zurück und stellte das Kabinett in Weimar vor die Wahl: bedingungslose Zustimmung oder Ablehnung. Am 23. Januar 1919 teilte die deutsche Regierung den Siegermächten in Versailles mit, dass Deutschland ohne Vorbehalte unterschreiben würde. Am 28. Juni 1919 setzte der neue Außenminister, der Sozialdemokrat Hermann Müller, seine Unterschrift unter den Vertrag. Anfang 1920 trat er in Kraft.
Der Friedensvertrag zwang das Deutsche Reich, Elsass-Lothringen an Frankreich abzutreten. Im Osten fielen die Provinz Posen, Teile West- und Ostpreußens sowie Hinterpommern an Polen. Das Reich verlor „13 % seiner Fläche und 10 % seiner Bevölkerung“ (Niedhardt 1999, S. 8). Im südlichen Teil von Ostpreußen, in Nord-Schleswig in Eupen-Malmedy an der deutsch-belgischen Grenze und in Oberschlesien sollten Volksabstimmungen durchgeführt werden. Den Deutschen im ehemaligen Kaiserreich Österreich-Ungarn, die sich mehrheitlich für einen Beitritt zum Deutschen Reich ausgesprochen hatten, wurde das Selbstbestimmungsrecht verwehrt. Das Saarland wurde dem Völkerbund unterstellt (dem Deutschland vorerst nicht beitreten durfte). Die Kohlengruben gelangten in französischen Besitz. Nach 15 Jahren sollten die Saarländer über ihre Zukunft abstimmen dürfen. Die Friedensstärke von Heer und Marine wurde auf 100 000 beschränkt. Die Präsenzstärke der Flotte durfte 15 000 Mann nicht überschreiten. Eine alliierte Kommission sollte die einseitige Abrüstung kontrollieren. Deutsche Truppen durften nicht im Rheinland stationiert werden, das zudem 15 Jahre lang unter alliierter Besetzung verbleiben musste. Der größte Teil der deutschen Handelsflotte war den Siegern zu übergeben. Die Reparationssumme stand immer noch nicht fest. Als erste Rate mussten bis 1921 20 Milliarden Goldmark gezahlt werden (vgl. Niedhardt 1999, S. 9).
Die Bedingungen fielen äußerst hart aus. Zur Unterzeichnung des Vertrages gab es jedoch keine Alternative (vgl. Hildebrand 1996, S. 392). Hätte Deutschland nicht unterschrieben, wären die Kampfhandlungen wieder aufgenommen worden. General Groener von der Obersten Heeresleitung hatte Reichskanzler Bauer am 23. Juni 1919 unmissverständlich klar gemacht, dass die deutschen Truppen nicht in der Lage wären, die Reichsgrenzen zu schützen (Dok. 729 in Ursachen und Folgen, Band 3 1959, S. 386). Oberstleutnant Ernst van den Bergh, ein Offizier, der im Büro des Reichswehrministers eingesetzt war, lehnte militärische Abenteuer ebenfalls ab: „Viele sind sich nicht klar darüber, daß die moralische und physische Spannkraft des Volkes noch immer zu schwach ist und selbst durch solch schwere Bedingungen und Demütigungen noch zu keiner großen Kraftleistung zu bringen ist“ (Wette 1991, S. 96). Friedrich von Payer, der Fraktionsvorsitzende der DDP, musste seine Kollegen am 19. Juni 1919 ermahnen, die Angelegenheit mit „Würde – aber auch Vernunft, nicht wie ein junger Mann oder Corpsstudent zu behandeln … (Albertin/Wegner 1980, S. 335)“.
Bis in die SPD hinein bediente man sich in diesen Tagen einer national eingefärbten Rhetorik. Bernhard Guttmann, ein einflussreicher liberaler Journalist, fand in seinen Erinnerungen kritische Worte für das Verhalten vieler Politiker und Militärs:
„Auch in dieser sehr ernsthaften Krise, die Deutschland an den Rand der Zerstörung brachte, war der Mangel an Verantwortlichkeit und staatsmännischer Besinnung erkennbar“ (Guttmann 1950, S. 172).
Ein anderer Zeitzeuge, der linksliberale Anton Erkelenz erinnerte sich zehn Jahre später an die entscheidenden Tage:
„Zentrum und Sozialdemokratie hatten in jenen Stunden wohl ein richtigeres Gefühl dafür, was man den Massen des Volkes, besonders auch im Rheinland, zumuten konnte. Heroischer war der Standpunkt der Mehrheit der Demokraten. Vermutlich wird man sich über die Richtigkeit des einen oder anderen Weges streiten, solange überhaupt der Weltkrieg in der Geschichte noch behandelt wird (Erkelenz 1929, S. 63)“.
Als Erkelenz diese Zeilen niederschrieb, hatte sich die außenpolitische Situation Deutschlands deutlich verbessert. Das Reich zählte wieder zum Kreis der gleichberechtigten Großmächte in Europa. Bei Vertragsabschluss schien die Perspektive dagegen sehr düster zu sein. Allerdings hatte die deutsche Politik sich an die Illusion geklammert, der Friede würde nicht zu hart ausfallen und damit unrealistische Erwartungen geschürt (vgl. Hildebrand 1996, S. 396). Außerdem hatte es bis dahin in Friedensverträgen keine Kriegsschuldzuweisungen gegeben. Die Höhe der Reparationen war ungewöhnlich; ebenso die Eingriffsrechte der Sieger in die inneren Angelegenheiten Deutschlands. Hinzu kam eine ungerechtfertigte internationale Ächtung des Reiches. Dem Völkerbund durften die Deutschen vorerst nicht beitreten.
Mittel- und langfristig bot der Versailler Vertrag dem Deutschen Reich große Chancen, wie Wolfgang Michalka aus der Warte des Historikers feststellte. Die Reichseinheit blieb erhalten. Als wirtschaftliche Großmacht profitierte es von den Veränderungen auf der europäischen Landkarte. Als reine Kontinentalmacht war es für England keine Konkurrenz mehr. Die Schwäche der noch jungen Sowjetunion wirkte sich zum Vorteil der Weimarer Republik aus (vgl. Michalka in Bracher/Funke/Jacobsen 1987, S. 307). Nicht zu vergessen ist, dass auch Frankreich und England wirtschaftlich erschöpft waren. Paris hatte nur einen Teil seiner Ziele durchgesetzt. Hans-Christof Kraus kam 2013 zu dem Schluss:
„Aus der Perspektive des frühen 21. Jahrhunderts wird immer mehr der Kompromisscharakter dieses – für Deutschland freilich überaus harten – Friedens deutlich: Es war eben auch nicht jener ‚karthagische Friede‘, den einflussreiche Politiker und große Teile der öffentlichen Meinung in den Siegerstaaten gefordert hatten (Kraus 2013, S. 33)“.
Zunächst aber empfanden die Deutschen den Versailler Vertrag als grausames Unrecht. Dass das Kaiserreich im Falle eines Sieges den Alliierten sehr harte Bedingungen aufgezwungen hätte, ignorierten viele Deutsche. Die pauschale Schuldzuweisung der Siegermächte verhinderte in der deutschen Öffentlichkeit eine Auseinandersetzung über die Fehler der wilhelminischen Außenpolitik (Winkler 1984, S. 226).
In England und den Vereinigten Staaten wuchs nach 1919 die Kritik am Versailler Vertrag. Man hielt ihn für ungerecht (vgl. MacMillan 2015, S. 628). Der amerikanische Senat ratifizierte den Versailler Vertrag nicht. Deutschland und die Vereinigten Staaten schlossen 1921 in Berlin einen Separatfrieden.
Die junge Republik musste in den ersten Monaten ihres Bestehens großen Herausforderungen trotzen. Die Konkursmasse des wilhelminischen Obrigkeitsstaates war eine schwere Hypothek. Aber es war gelungen, den 1871 gegründeten Nationalstaat zu bewahren. Die deutsche Republik im Innern zu festigen und zu einem demokratischen Gemeinwesen auszugestalten, war die zweite große Aufgabe, vor der die Abgeordneten in Weimar standen.
Weitergehende Informationen:
https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/das-junge-politik-lexikon/321320/versailler-vertrag/
Teil 2 der Geschichte der Weimarer Republik.
Weiterführende Informationen:
LeMO Kapitel – Weimarer Republik – Außenpolitik – Versailler Vertrag (dhm.de)
Pariser Friedensordnung (bpb.de)
Unveröffentlichte Quellen:
Nachlass Anton Erkelenz im Bundesarchiv Koblenz
Nachlass Friedrich von Payer im Bundesarchiv Koblenz
Gedruckte Quellen:
Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918 – 1945, Serie A: 1918 – 1925. Band 1: 9. November 1918 bis 5. Mai 1919, Göttingen 1982 (ADAP)
Lothar Albertin, Konstanze Wegner (Hrsg.): Linksliberalismus in der Weimarer Republik. Die Führungsgremien der deutschen Demokratischen Partei und der Deutschen Staatspartei 1918 – 1933, Düsseldorf 1980
Graf Brockdorff-Rantzau, Dokumente, Charlottenburg 1920
Herbert Michaelis, Ernst Schraepler (Hrsg.): Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart. Eine Urkunden- und Dokumentensammlung zur Zeitgeschichte. Band 2: Der militärische Zusammenbruch und das Ende des Kaiserreiches, Berlin 1959
Herbert Michaelis, Ernst Schraepler (Hrsg.): Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart. Eine Urkunden- und Dokumentensammlung zur Zeitgeschichte. Band 3: Der Weg in die Weimarer Republik, Berlin 1959
Wolfram Wette (Hrsg.): Aus den Geburtsstunden der Weimarer Republik. Das Tagebuch des Obersten Ernst van den Bergh, Düsseldorf 1991
Literatur:
Ursula Büttner, Weimar – die überforderte Republik 1918 – 1933, in: Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschichte. 10., völlig neu bearbeitete Auflage, Stuttgart 2010, S. 173 – 812
Klaus Epstein, Erzberger und der Kampf um die Ratifizierung des Versailler Vertrages, in Eberhard Kolb (Hrsg.): Vom Kaiserreich zur Weimarer Republik, Köln 1972, S. 308 – 329
Anton Erkelenz, Erinnerungen aus der Nationalversammlung, in: Die Hilfe, Nr. 2 vom 15. Januar 1959
Erich Eyck, Geschichte der Weimarer Republik, Band 1: Vom Zusammenbruch des Kaisertums bis zur Wahl Hindenburgs, 3. Aufl., Zürich, Stuttgart 1959
Robert Gerwarth, Die größte aller Revolutionen. November 1918 und der Aufbruch in eine neue Zeit, München 2019
Bernhard Guttmann, Schattenriss einer Generation 1888 – 1919, Stuttgart 1950
Peter Grupp, Vom Waffenstillstand zum Versailler Vertrag. Die außen- und friedenspolitischen Zielvorstellungen der deutschen Reichsführung, in: Karl-Dietrich Bracher, Manfred Funke, Hans-Adolf Jacobsen (Hrsg.): Die Weimarer Republik 1918 – 1933. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Bonn 1987, S. 285 – 302
Klaus Hildebrand, Das vergangene Reich. Deutsche Außenpolitik von Bismarck bis Hitler, 2. Aufl., Zürich 1996
Hans-Christof Kraus, Versailles und die Folgen. Außenpolitik zwischen Revisionismus und Verständigung 1919 – 1933, Berlin 2013
Peter Krüger, Deutschland und die Reparationen 1918/19. Die Genesis des Reparationsproblems in Deutschland zwischen Waffenstillstand und Versailler Friedensschluß, Stuttgart 1973
Margaret MacMillan, Die Friedensmacher. Wie der Versailler Vertrag die Welt veränderte, Berlin 2015
Wolfgang Michalka, Deutsche Außenpolitik 1920 – 1933 in: Karl-Dietrich Bracher, Manfred Funke, Hans-Adolf Jacobsen (Hrsg.): Die Weimarer Republik 1918 – 1933. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Bonn 1987, S. 303 – 326
Gottfried Niedhardt, Die Außenpolitik der Weimarer Republik, München 1999
Heinrich August Winkler, Von der Revolution zur Stabilisierung. Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1918 bis 1924, Berlin, Bonn 1984
Ludwig Zimmermann, Deutsche Aussenpolitik in der Ära der Weimarer Republik, Göttingen, Berlin, Frankfurt 1958

